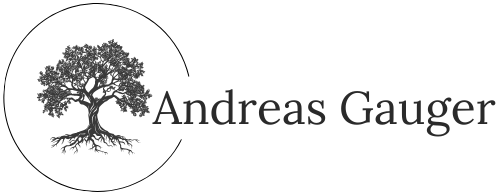Ein Komplextrauma entsteht nicht durch einen einzigen Schockmoment, sondern durch eine Realität, die über Jahre hinweg von Unsicherheit, Bedrohung oder Ohnmacht geprägt war. Es ist das Trauma der anhaltenden Gefangenschaft – sei sie physisch oder emotional.
Viele Betroffene erkennen sich in klassischen Trauma-Definitionen nicht wieder. Sie haben keinen schweren Unfall erlebt, keinen Krieg durchgemacht, keine einmalige Katastrophe überlebt.
Und doch zeigen sie schwerwiegende Traumasymptome: chronische Unruhe, Identitätsprobleme, zerstörerische Beziehungsmuster.
Die Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (KPTBS) – 2018 offiziell in die ICD-11 aufgenommen – erklärt diese scheinbare Diskrepanz. Sie entsteht durch wiederholte, langanhaltende Traumatisierung, der man nicht entkommen konnte.
In diesem Artikel erfährst du:
- Was KPTBS wissenschaftlich definiert und wie sie sich von klassischer PTBS unterscheidet
- Die neurologischen und psychologischen Mechanismen dahinter
- Wie sich KPTBS in Beziehungen und im Selbstbild zeigt
- Welche evidenzbasierten Behandlungsansätze es gibt
Was ist eine Komplexe PTBS? Die offizielle Definition
Die Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung wurde erstmals 1992 von der Traumaforscherin Judith Herman beschrieben.
Sie erkannte, dass Menschen, die wiederholtem, anhaltendem Trauma ausgesetzt waren – besonders in Situationen, denen sie nicht entkommen konnten – andere Symptome zeigten als klassische PTBS-Patienten.
2018 wurde KPTBS offiziell in die ICD-11 (die internationale Klassifikation der Krankheiten der WHO) aufgenommen. Die Diagnose erfordert:
Die Kernsymptome der klassischen PTBS:
- Wiedererleben: Flashbacks, Albträume, intensive Erinnerungen
- Vermeidung: von Menschen, Orten, Gedanken, die an das Trauma erinnern
- Übererregung: Schlafstörungen, Reizbarkeit, übermäßige Wachsamkeit
Plus drei zusätzliche Symptomkomplexe, die KPTBS definieren:
1. Schwere Störungen der Emotionsregulation
Das bedeutet: Gefühle sind entweder überwältigend intensiv oder komplett abgeschaltet. Betroffene berichten von unkontrollierbaren Wutausbrüchen, lähmender Scham oder emotionaler Taubheit. Das Nervensystem kennt kein "Mittelmaß" mehr – es pendelt zwischen Extremen.
2. Negatives Selbstkonzept
Menschen mit KPTBS haben ein tief verwurzeltes Gefühl, "beschädigt", "wertlos" oder "fundamental anders" zu sein. Das ist nicht nur schlechte Stimmung oder geringes Selbstwertgefühl – es ist eine Kernüberzeugung über die eigene Person, die alle Lebensbereiche durchdringt.
3. Störungen in Beziehungen
Nähe fühlt sich bedrohlich an, Distanz unerträglich. Betroffene ziehen sich zurück oder klammern verzweifelt. Sie erwarten Verrat, auch wo keiner droht. Gesunde Beziehungen scheinen unmöglich – ein Teufelskreis aus Sehnsucht und Angst.
Der entscheidende Unterschied zur klassischen PTBS
Bei der klassischen PTBS steht das traumatische Ereignis im Zentrum – der Unfall, der Überfall, die Naturkatastrophe. Die Symptome kreisen um diese spezifische Erinnerung.
Bei KPTBS gibt es oft kein einzelnes "Schlüsselereignis". Stattdessen ist es die kumulative Wirkung vieler "kleiner" Traumata: Die tägliche Angst vor dem unberechenbaren Elternteil.
Die jahrelange emotionale Manipulation in einer toxischen Beziehung. Die chronische Vernachlässigung, die einem Kind zeigt: "Du bist es nicht wert."
Herman beschreibt es so: "Während ein einzelnes Trauma die Persönlichkeit erschüttern kann, formt wiederholtes Trauma sie neu."
Wie entsteht eine Komplexe PTBS?
KPTBS entsteht typischerweise in Situationen anhaltender Hilflosigkeit. Das können sein:
Kindheitstrauma:
Missbrauch, Vernachlässigung oder das Aufwachsen mit psychisch kranken oder süchtigen Eltern. Das Kind kann der Situation nicht entkommen und muss sich anpassen, um zu überleben.
Häusliche Gewalt:
Jahre in einer Beziehung, die von Kontrolle, Manipulation und Gewalt geprägt ist. Die Betroffenen sind oft emotional, finanziell oder durch Kinder gebunden.
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Sekten:
Situationen extremer Kontrolle und Ausbeutung, in denen die Identität systematisch gebrochen wird.
Kriegsgefangenschaft, Folter:
Anhaltende Bedrohung von Leben und Würde ohne Fluchtmöglichkeit.
Der gemeinsame Nenner: Die Person ist gefangen – physisch oder psychisch – und muss über lange Zeit in einem Zustand von Bedrohung und Ohnmacht ausharren.
Die neurobiologischen Folgen
Chronischer, unentrinnbarer Stress verändert dein Gehirn messbar. Der Hippocampus (zuständig für Gedächtnisbildung) schrumpft – Erinnerungen bleiben fragmentiert und überwältigend.
Deine Amygdala (das Angstzentrum) wird überaktiv – harmlose Reize lösen Alarmreaktionen aus. Dein präfrontaler Kortex (für rationale Kontrolle) wird heruntergefahren – Impulskontrolle und Emotionsregulation brechen zusammen.
Diese Veränderungen sind nicht "Einbildung" oder "Schwäche" – sie sind nachweisbare neurologische Anpassungen an eine unerträgliche Realität.
Wie KPTBS dein Selbstbild zerstört
Menschen mit KPTBS kämpfen nicht nur mit Erinnerungen – sie kämpfen mit der Frage, wer sie überhaupt sind. Das Trauma hat nicht nur ihre Sicherheit zerstört, sondern ihr fundamentales Selbstgefühl.
Fragmentiertes Selbst
Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, aus verschiedenen "Teilen" zu bestehen, die nicht zusammenpassen. Vielleicht kennst du das auch. Da ist der funktionierende Teil, der zur Arbeit geht und Verantwortung übernimmt.
Der verletzliche Teil, der sich wie ein hilfloses Kind fühlt. Der wütende Teil, der am liebsten alles zerstören würde. Der taube Teil, der nichts mehr fühlt.
Diese Fragmentierung ist keine multiple Persönlichkeit – es ist eine Überlebensstrategie. Wenn das ganze Selbst zu überwältigend ist, spaltet die Psyche Teile ab.
Was in der Traumasituation Schutz bot, wird später zum Problem: Die Person fühlt sich innerlich zerrissen, ohne kohärente Identität.
Verinnerlichte Täterperspektive
Besonders zerstörerisch: Viele Betroffene haben die Sicht des Täters übernommen. Ein Kind, das misshandelt wird, kann nicht begreifen, dass die Eltern "schlecht" sind – das wäre zu bedrohlich. Stattdessen schließt es: "Ich bin schlecht. Ich habe es verdient."
Diese Täterintrojekte – verinnerlichte abwertende Stimmen – werden Teil deines Selbstkonzepts. Auch Jahre nach dem Trauma hörst du innerlich die Worte: "Du bist wertlos. Du stellst dich an. Es ist deine Schuld."
Du glaubst, das seien deine eigenen Gedanken. In Wahrheit ist es die Stimme des Täters, die weiterlebt.
Scham als Kernemotion
Während Schuld sagt "Ich habe etwas Falsches getan", sagt Scham "Ich BIN falsch". Menschen mit KPTBS leben oft in chronischer Scham. Sie schämen sich für ihre Symptome, ihre Bedürfnisse, ihre bloße Existenz.
Diese toxische Scham ist lähmend. Sie verhindert, dass Betroffene Hilfe suchen ("Ich habe es nicht verdient"), Grenzen setzen ("Wer bin ich, dass ich Nein sage?") oder Erfolge annehmen ("Das war nur Glück, ich bin ein Betrüger").
KPTBS in Beziehungen: Zwischen Sehnsucht und Terror
Beziehungen sind für Menschen mit KPTBS das ultimative Dilemma. Einerseits sehnen sie sich verzweifelt nach Verbindung – andererseits ist Nähe mit Gefahr verknüpft.
Das desorganisierte Bindungsmuster
Viele Betroffene zeigen ein desorganisiertes Bindungsverhalten: Sie suchen Nähe und stoßen gleichzeitig weg. Sie klammern und fliehen. Sie idealisieren und dämonisieren. Für Partner ist das verwirrend und erschöpfend.
Dieses Chaos ist kein "Drama" oder "Spielchen" – es spiegelt die ursprüngliche Traumasituation:
Wenn die Person, die Schutz bieten sollte (Elternteil, Partner), gleichzeitig die Quelle der Gefahr war, lernt dein Nervensystem: Nähe bedeutet gleichzeitig Sicherheit UND Bedrohung.
Dieser Widerspruch ist unlösbar.
Reinszenierung und Wiederholungszwang
Freud nannte es Wiederholungszwang, moderne Traumaforscher sprechen von Reinszenierung: Betroffene geraten immer wieder in Situationen, die dem ursprünglichen Trauma ähneln.
Die Frau, die mit einem gewalttätigen Vater aufwuchs, findet sich in Beziehungen mit kontrollierenden Männern. Der Mann, der emotional vernachlässigt wurde, zieht Partner an, die ihn ignorieren.
Das ist keine masochistische Neigung. Das Nervensystem sucht das Vertraute – und vertraut ist, was in der Kindheit normal war, selbst wenn es schädlich war. Zudem gibt es die unbewusste Hoffnung, es "diesmal richtig zu machen" – endlich die Liebe zu bekommen, die damals fehlte.
Toxische Beziehungen als Re-Traumatisierung
Menschen mit KPTBS haben ein erhöhtes Risiko, in toxischen Beziehungen zu landen. Ihre "Normalität" ist verzerrt – Warnsignale werden nicht erkannt oder rationalisiert. Manipulation fühlt sich vertraut an. Love-Bombing wird mit echter Liebe verwechselt.
Besonders gefährlich: Trauma-Bonding in missbräuchlichen Beziehungen. Der Wechsel zwischen Misshandlung und Zuwendung erzeugt eine suchtartige Bindung – dieselbe Dynamik, die oft schon in der Kindheit bestand.
KPTBS und Borderline: Was hängt womit zusammen?
Eine der kontroversesten Fragen in der Traumaforschung: Ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung eigentlich eine Form von KPTBS? Und was ist mit anderen Persönlichkeitsstörungen?
Die Überschneidungen sind enorm
Tatsächlich zeigen bis zu 75% der Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Trauma-Historie. Die Symptome überlappen sich stark: Emotionale Dysregulation, Identitätsstörungen, selbstverletzendes Verhalten, chaotische Beziehungen.
Viele Fachleute argumentieren, dass Borderline oft eine Fehldiagnose ist – eigentlich handelt es sich um KPTBS.
Judith Herman selbst schrieb: "Die Patienten, die wir als 'Borderline' diagnostizieren, sind größtenteils Überlebende schwerer, anhaltender Kindheitstraumata."
Andere Forscher wie Bessel van der Kolk sehen es ähnlich: Die Symptome, die wir als "Persönlichkeitsstörung" labeln, sind eigentlich Anpassungsreaktionen auf chronisches Trauma.
Warum die Unterscheidung trotzdem wichtig ist
Nicht jeder mit Borderline hat KPTBS, und nicht jeder mit KPTBS entwickelt Borderline-Symptome. Die Unterschiede:
Borderline wird als Persönlichkeitsstörung verstanden – ein tief verwurzeltes, stabiles Muster, das alle Lebensbereiche durchdringt. Die Identitätsstörung und Beziehungsprobleme stehen im Vordergrund.
KPTBS ist eine Traumafolgestörung – die Symptome sind direkt auf traumatische Erfahrungen zurückzuführen. Die Trauma-Symptome (Flashbacks, Vermeidung, Übererregung) sind zentral.
In der Praxis ist die Abgrenzung oft schwierig. Viele Menschen erfüllen die Kriterien für beide Diagnosen. Der Unterschied liegt oft im Behandlungsfokus: Bei KPTBS steht Traumaverarbeitung im Zentrum, bei Borderline die Stabilisierung der Persönlichkeitsstruktur.
Die Gefahr der Stigmatisierung
Die Diagnose "Persönlichkeitsstörung" trägt ein enormes Stigma. Sie suggeriert, dass etwas mit der Person fundamental "falsch" ist.
Viele Betroffene berichten, dass sie nach der Borderline-Diagnose schlechter behandelt wurden – als "schwierig", "manipulativ" oder "unheilbar" abgestempelt.
Die KPTBS-Diagnose ist oft hilfreicher. Sie macht klar: Das sind Traumafolgen, keine Charakterfehler. Sie erklärt die Symptome als normale Reaktion auf abnormale Umstände. Und sie gibt Hoffnung – Trauma kann heilen.
Was ist mit narzisstischer und antisozialer Persönlichkeitsstörung?
Hier wird es noch kontroverser. Einige Theoretiker – wie Sam Vaknin – argumentieren, dass auch narzisstische Persönlichkeitsstörung eine Form von KPTBS sein könnte. Die Idee: Das "falsche Selbst" des Narzissten ist eine Schutzreaktion auf frühe Traumatisierung.
Die Forschung zeigt hier jedoch ein anderes Bild. Während viele Menschen mit Borderline eindeutige Traumata in ihrer Geschichte haben, ist das bei narzisstischer oder antisozialer Persönlichkeitsstörung seltener der Fall.
Die Studien deuten eher auf eine Kombination aus genetischen Faktoren, Temperament und Umwelteinflüssen hin – nicht primär auf Trauma.
Wichtig: Selbst wenn Trauma eine Rolle spielt, rechtfertigt das kein missbräuchliches Verhalten. Menschen mit KPTBS oder Borderline kämpfen hauptsächlich mit sich selbst. Menschen mit narzisstischer oder antisozialer Persönlichkeitsstörung schädigen primär andere.
Die neue Perspektive: Dimensionale Diagnostik
Die aktuelle Forschung bewegt sich weg von starren Kategorien. Die ICD-11 führt einen dimensionalen Ansatz für Persönlichkeitsstörungen ein: Statt "Borderline" oder "Narzissmus" werden Schweregrad und spezifische Merkmale (wie Emotionsregulation oder zwischenmenschliche Funktion) erfasst.
Das macht Sinn, denn in der Realität gibt es massive Überschneidungen. Eine Person kann KPTBS-Symptome haben, Borderline-Kriterien erfüllen und narzisstische Züge zeigen – alles als Folge komplexer Traumatisierung.
Fazit: Die Grenzen zwischen KPTBS und Persönlichkeitsstörungen sind unscharf. Wichtiger als die exakte Diagnose ist das Verständnis: Hinter den meisten dieser Symptome stehen Überlebensstrategien, die einmal lebensrettend waren und heute Leiden verursachen.
Behandlung von KPTBS: Was wirklich hilft
Die Behandlung von KPTBS unterscheidet sich grundlegend von der klassischen PTBS-Therapie. Während bei einzelnen Traumata oft eine direkte Konfrontation mit der Erinnerung hilft, brauchst du bei KPTBS einen anderen Weg.
Die drei Phasen der Traumatherapie
Die meisten traumaspezialisierten Therapeuten arbeiten nach einem Drei-Phasen-Modell, das Judith Herman entwickelt hat:
Phase 1: Stabilisierung und Sicherheit
Bevor alte Wunden bearbeitet werden können, muss erst einmal Sicherheit hergestellt werden – äußerlich und innerlich. Das bedeutet: Aus toxischen Situationen aussteigen, Selbstverletzung stoppen, den Alltag stabilisieren.
Gleichzeitig lernst du, dein Nervensystem zu regulieren und mit Flashbacks umzugehen.
Phase 2: Traumabearbeitung
Erst wenn genug Stabilität da ist, können die traumatischen Erinnerungen bearbeitet werden. Das passiert nicht durch einfaches "Drüber-Reden", sondern mit spezialisierten Methoden wie EMDR oder traumafokussierter Therapie.
Das Ziel: Die Erinnerungen verlieren ihre emotionale Wucht und werden zu normalen Erinnerungen – schlimm, aber vorbei.
Phase 3: Integration und Neuorientierung
In der letzten Phase geht es darum, ein neues Leben aufzubauen. Wer bin ich jenseits des Traumas? Was will ich vom Leben? Wie gestalte ich gesunde Beziehungen? Viele Betroffene entdecken hier zum ersten Mal, wer sie wirklich sind.
Wirksame Therapieformen bei KPTBS
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Bei EMDR folgen die Augen einer Handbewegung, während man an das Trauma denkt. Das klingt simpel, ist aber hochwirksam.
Die bilateralen Augenbewegungen helfen dem Gehirn, traumatische Erinnerungen neu zu verarbeiten und zu integrieren. Bei KPTBS dauert es oft länger als bei einfacher PTBS, weil so viele Erinnerungen verarbeitet werden müssen.
Traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (TF-KVT)
Diese Therapieform kombiniert das Sprechen über Trauma mit dem Erlernen praktischer Bewältigungsstrategien.
Betroffene lernen, wie Trauma ihre Gedanken und Überzeugungen geformt hat – und wie sie diese verändern können. Besonders hilfreich bei den negativen Selbstüberzeugungen der KPTBS.
Somatic Experiencing und körperorientierte Ansätze
Trauma sitzt im Körper – deshalb arbeiten diese Methoden direkt mit Körperempfindungen. Durch achtsames Spüren und sanfte Bewegungen wird das im Nervensystem "eingefrorene" Trauma gelöst. Besonders wichtig bei KPTBS, wo Worte oft nicht ausreichen.
DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie)
Ursprünglich für Borderline entwickelt, hilft DBT auch bei KPTBS. Der Fokus liegt auf vier Bereichen: Achtsamkeit, Stresstoleranz, Emotionsregulation und zwischenmenschliche Fertigkeiten.
Betroffene lernen konkrete Skills für den Alltag – vom Umgang mit Flashbacks bis zur Gestaltung gesunder Beziehungen.
Was Betroffene selbst tun können
Professionelle Hilfe ist bei KPTBS meist unverzichtbar. Trotzdem gibt es Dinge, die Betroffene selbst tun können:
Psychoedukation – je mehr du über KPTBS verstehst, desto weniger machst du dich für deine Symptome verantwortlich.
Stabilisierungstechniken für den Alltag: Atemübungen, Erdungsübungen (5 Dinge sehen, 4 hören, 3 fühlen...), sichere innere Orte visualisieren. Diese Techniken ersetzen keine Therapie, aber sie helfen, den Tag zu überstehen.
Soziale Unterstützung aufbauen – auch wenn es schwerfällt. KPTBS isoliert, aber Heilung braucht Verbindung. Selbsthilfegruppen, Online-Communities oder einzelne vertrauenswürdige Menschen können einen enormen Unterschied machen.
Trigger identifizieren und Strategien entwickeln. Was löst Flashbacks aus? Was hilft in akuten Krisen? Ein Notfallplan gibt Kontrolle zurück.
Die Grenzen der Selbsthilfe
Bei KPTBS ist Selbsthilfe wichtig, aber sie hat klare Grenzen. Das zerrüttete Selbstbild, die tiefen Beziehungswunden, die neurologischen Veränderungen – all das braucht professionelle Begleitung.
Besonders gefährlich: Der Versuch, traumatische Erinnerungen allein zu "verarbeiten". Ohne therapeutischen Rahmen kann das zu Retraumatisierung führen – die Symptome verschlimmern sich.
KPTBS ist keine Schwäche, die man mit genug Willenskraft überwinden kann. Es ist eine ernsthafte Traumafolgestörung, die spezialisierte Behandlung braucht.
Prognose: Ist Heilung möglich?
Die Frage, die alle Betroffenen umtreibt: Kann KPTBS heilen? Die Antwort ist komplex aber hoffnungsvoll.
Vollständige "Heilung" im Sinne von "als wäre nie etwas gewesen" ist unrealistisch. Die Erfahrungen bleiben Teil der Lebensgeschichte.
Aber – und das ist entscheidend – die Symptome können sich dramatisch verbessern. Menschen mit KPTBS können lernen, ihre Emotionen zu regulieren, sichere Beziehungen aufzubauen und ein positives Selbstbild zu entwickeln.
Die Forschung zeigt: Mit traumaspezifischer Therapie erreichen 60-70% der Betroffenen eine signifikante Symptomreduktion. Viele erfüllen nach der Behandlung nicht mehr die Diagnosekriterien. Der Weg ist lang – die Behandlung dauert oft Jahre – aber Veränderung ist möglich.
Was bleibt: Eine erhöhte Sensibilität, eine tiefere Kenntnis der eigenen Verwundbarkeit. Viele Betroffene beschreiben das nicht als Makel, sondern als Stärke. Sie haben die Hölle überlebt und kennen ihre Resilienz.
Leben mit KPTBS: Ein neuer Anfang, kein Ende
KPTBS zu haben bedeutet nicht, für immer "beschädigt" zu sein. Es bedeutet, dass du Dinge überlebt hast, die eigentlich nicht auszuhalten waren.
Dein Nervensystem hat sich angepasst, um dich zu schützen. Die Symptome, die heute Leiden verursachen, waren einmal Überlebensstrategien.
Die Realität anerkennen
Der erste Schritt ist oft der schwerste: Anerkennen, was passiert ist. Viele Betroffene verharmlosen ihre Erfahrungen – "Andere hatten es schlimmer" oder "Es war nicht so schlimm".
Doch Trauma bemisst sich nicht an objektiven Kriterien. Wenn es dich geprägt hat, war es schlimm genug.
Diese Anerkennung ist kein Selbstmitleid. Es ist der Beginn von Selbstmitgefühl. Du warst ein Kind, das in einer unmöglichen Situation das Beste getan hat. Du warst in einer Beziehung gefangen, aus der es keinen sicheren Ausweg gab. Die Verantwortung liegt nicht bei dir.
Der lange Weg der Heilung
Heilung von KPTBS ist kein linearer Prozess. Es gibt Fortschritte und Rückschläge, gute Tage und Krisen. Manche Trigger verschwinden, andere bleiben. Das ist normal und kein Zeichen von Versagen.
Was sich verändert: Die Abstände zwischen den Krisen werden größer. Die Erholung geht schneller. Die Trigger verlieren an Macht.
Wo früher wochenlange Abstürze waren, sind irgendwann nur noch Stunden oder Tage. Wo Panik war, ist später Unbehagen. Wo Selbsthass war, entsteht langsam Selbstakzeptanz.
Jenseits der Diagnose
KPTBS erklärt vieles, aber sie definiert dich nicht. Du bist mehr als deine Symptome, mehr als deine Geschichte, mehr als dein Trauma. Menschen mit KPTBS entwickeln oft besondere Stärken:
Hohe Empathie, kreative Problemlösung, tiefe Resilienz, intensive Verbundenheit mit anderen Überlebenden.
Viele Betroffene berichten, dass sie durch die Heilungsarbeit nicht nur ihre Symptome verloren, sondern sich selbst gefunden haben. Zum ersten Mal im Leben spüren sie, wer sie wirklich sind – jenseits der Anpassung, jenseits der Überlebensstrategien.
Tiefer eintauchen
Hier findest du weiterführende Artikel zu angrenzenden Themen:
Trauma Bonding: Wenn loslassen unmöglich scheint – und wie es doch gelingt
Entwicklungstrauma: Die unsichtbare Epidemie unserer Zeit
Literatur/Quellen:
*Herman, J. L. (2018). Die Narben der Gewalt: Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. Junfermann Verlag.
*van der Kolk, B. (2015). Verkörperter Schrecken: Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper. Probst Verlag.
*Walker, P. (2017). Posttraumatische Belastungsstörung vom Typ II: Wie chronische Traumatisierung in der Kindheit unser Leben prägt. [Deutsche Übersetzung in Vorbereitung]
*Reddemann, L. (2017). Imagination als heilsame Kraft: Zur Behandlung von Traumafolgen. Klett-Cotta.
*Reddemann, L. (2019). Überlebenskunst: Von Johann Sebastian Bach lernen und Selbstheilungskräfte entwickeln. Klett-Cotta.
*Huber, M. (2012). Der innere Garten: Ein achtsamer Weg zur persönlichen Veränderung. Junfermann.