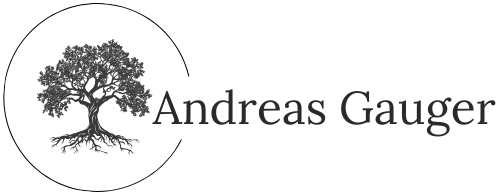Die sogenannten Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen fallen besonders durch dramatisches, impulsives und emotional instabiles Verhalten auf.
Menschen mit diesen Störungen zeigen häufig starke Stimmungsschwankungen, intensive, aber instabile Beziehungsmuster und ein ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken.
Diese emotionale Intensität belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihr Umfeld erheblich. Zwischenmenschliche Beziehungen – ob in Partnerschaft, Familie, Freundeskreis oder Beruf – gelten im Kontakt mit Cluster-B-Persönlichkeiten als besonders herausfordernd.
Hinweis: Dieser Artikel ist ein Fachbeitrag im wissenschaftlichen Stil und richtet sich an fachlich Interessierte, die sich vertieft mit den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen befassen möchten. Wenn du dagegen gerade unter jemandem leidest, bei dem du eine solche Störung vermutest und konkrete Unterstützung suchst, findest du auf dieser Seite zahlreiche praxisnahe Artikel, die dir im Alltag Orientierung geben.
Umfang der Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen
Zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen gehören vier Störungsbilder:
- Narzisstische Persönlichkeitsstörung – geprägt von Grandiosität, Manipulation und mangelnder Empathie.
- Borderline-Persönlichkeitsstörung – emotionale Instabilität, Angst vor Verlassenwerden und selbstschädigendes Verhalten.
- Histrionische Persönlichkeitsstörung – übermäßiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und theatralische Selbstdarstellung.
- Dissoziale Persönlichkeitsstörung (Psychopathie) – rücksichtsloses Verhalten ohne Schuldgefühle oder Reue.
💡 Nicht jeder emotional herausfordernde Mensch leidet an einer Persönlichkeitsstörung. Die Diagnose erfordert spezifische Kriterien und professionelle Beurteilung.
Die Unterscheidung dieser Störungsbilder ermöglicht eine bessere Einordnung problematischer Verhaltensmuster im sozialen Umfeld.
Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen: Nähe, Distanz und der Kampf um den Selbstwert
Menschen mit einer Cluster-B-Persönlichkeitsstörung haben oft Schwierigkeiten, stabile und tragfähige Beziehungen zu führen.
Vor allem die Regulation von Nähe und Distanz bereitet Probleme: Die Wahrnehmung schwankt zwischen intensiver Idealisierung und plötzlicher Entwertung.
Anfangs wird ein Partner überhöht und fast perfekt gesehen, nach einiger Zeit kippt die Sichtweise ins Gegenteil – dieselbe Person erscheint nun völlig unzulänglich.
Diese Schwankungen folgen nicht der Realität, sondern spiegeln die innere Instabilität der Betroffenen wider.
Das belastet beide Seiten stark. Partner berichten häufig von emotionaler Erschöpfung durch die unvorhersehbaren Stimmungswechsel, während die Betroffenen selbst unter ihrer eigenen inneren Achterbahnfahrt leiden.
Die typischen Zyklen von Idealisierung und Entwertung sind ein zentrales Merkmal der Cluster-B-Dynamik und erklären viele der verwirrenden Beziehungsmuster.
Emotionale Instabilität und selbstschädigendes Verhalten
Selbstschädigendes Verhalten, emotionale Ausbrüche und Aggressionen sind häufige Merkmale der Cluster-B-Störungen. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung liegt die Suizidrate bei etwa 10 Prozent – eine alarmierend hohe Zahl.
Allen Cluster-B-Störungen gemeinsam ist eine Instabilität des Selbstwertgefühls. Jede Störung entwickelt eigene Bewältigungsstrategien, doch ein Muster zeigt sich bei allen: Schwierigkeiten, mit Kritik oder fehlender Anerkennung umzugehen.
Die Betroffenen brauchen konstante Bestätigung ihrer Bedeutsamkeit. Bei Narzissmus zeigt sich dies als Grandiosität, bei Borderline als intensive Angst vor Verlassenwerden, bei Histrionik als starkes Aufmerksamkeitsstreben.
Wird dieses fragile Selbstbild erschüttert – durch Kritik, Zurückweisung oder fehlende Bestätigung – reagieren die Betroffenen oft impulsiv:
- Narzisstische Personen entwerten den Kritiker.
- Menschen mit Borderline können sich selbst verletzen oder mit Suizid drohen.
- Histrionische Persönlichkeiten inszenieren dramatische Zusammenbrüche.
- Dissoziale Persönlichkeiten reagieren mit Rachegedanken.
Diese Reaktionen sind häufig unverhältnismäßig und eskalieren Situationen, die von außen betrachtet harmlos erscheinen. So kann aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit ein heftiger Konflikt entstehen.
Für das Umfeld bedeutet das: Gestern noch erlebte Nähe und Zuneigung kann sich plötzlich in Ablehnung oder Gleichgültigkeit verwandeln – ohne erkennbaren Auslöser.
Manipulation statt Mitgefühl – Warum echte Empathie fehlt
Menschen mit einer Cluster-B-Persönlichkeitsstörung zeigen oft deutliche Defizite in der emotionalen Empathie. Sie können zwar nachvollziehen, was andere denken oder fühlen (kognitive Empathie), doch das emotionale Mitschwingen bleibt häufig aus.
Bei der narzisstischen und der dissozialen Persönlichkeitsstörung ist dieser Mangel besonders ausgeprägt. Andere Menschen werden dort vor allem als Mittel zum Zweck wahrgenommen – als Quelle für Bewunderung, Status oder Vorteile.
Gleichzeitig haben viele Betroffene ein ausgeprägtes Gespür für die Schwachstellen anderer. Diese Wahrnehmung dient jedoch nicht dem Mitgefühl, sondern wird strategisch genutzt.
Ein Beispiel: Persönliche Unsicherheiten, die in einer frühen Beziehungsphase erfragt wurden, können später in Konflikten gezielt gegen die andere Person eingesetzt werden.
Dieses Phänomen wird als instrumentelle Empathie bezeichnet: Betroffene verstehen sehr genau, was andere fühlen – nutzen dieses Wissen aber ausschließlich für eigene Ziele.
Bei der Borderline-Störung zeigt sich ein anderes Muster: Mitgefühl kann in stabileren Phasen durchaus vorhanden sein, verschwindet aber in emotionalen Krisen oft völlig.
Die histrionische Persönlichkeitsstörung wiederum ist geprägt von emotionaler Theatralik: Gefühle wirken oft oberflächlich und eher wie eine Inszenierung, die Aufmerksamkeit sichern soll, statt wie echtes Mitgefühl.
Diese Empathiedefizite erklären, warum Beziehungen mit Cluster-B-Persönlichkeiten von außen betrachtet oft emotional einseitig wirken.
Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen kommen selten allein
Persönlichkeitsstörungen lassen sich in der Praxis selten scharf voneinander trennen. Besonders innerhalb des Cluster-B-Spektrums gibt es starke Überschneidungen – Komorbidität ist eher die Regel als die Ausnahme.
So zeigen zum Beispiel viele Menschen mit Borderline-Störung auch narzisstische Merkmale. Umgekehrt können narzisstische Persönlichkeiten unter starkem Stress borderline-ähnliche Symptome entwickeln, etwa Selbstverletzungen oder Suiziddrohungen.
Auch bei der dissozialen Störung finden sich in Studien häufig Überschneidungen mit Narzissmus – beide teilen Eigenschaften wie mangelnde Empathie und die Tendenz, andere auszunutzen.
Menschen mit histrionischer Störung wiederum zeigen oft sowohl narzisstische Elemente wie Grandiosität als auch borderline-typische Züge wie emotionale Instabilität.
Die Grenzen sind fließend. Obwohl die diagnostischen Handbücher klare Kategorien vorgeben, zeigt die klinische Realität häufig komplexe Mischbilder.
So kann eine Patientin die Kriterien für Borderline erfüllen, gleichzeitig aber narzisstische und histrionische Merkmale aufweisen. In solchen Fällen richtet sich die Hauptdiagnose nach dem Muster, das am deutlichsten dominiert.
Ein neuer Ansatz: Das Ende der starren Diagnosen?
Bisher wurden Persönlichkeitsstörungen in starre Kategorien eingeteilt – etwa in Narzissmus, Borderline oder Histrionik. Mit der ICD-11, die in Deutschland noch nicht vollständig umgesetzt ist, verfolgt die Weltgesundheitsorganisation einen neuen Ansatz.
Statt fester Schubladen nutzt sie ein dimensionales Modell:
- Zunächst wird der Schweregrad beschrieben – leicht, mittel oder schwer.
- Dann werden pathologische Merkmalsbereiche erfasst, etwa negative Affektivität, Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung oder Zwanghaftigkeit (Anankasmus).
- Für bestimmte Muster – wie die Borderline-Störung – kann zusätzlich eine spezifische Qualifikation vergeben werden.
Ein Beispiel: Anstelle der Diagnose „Narzisstische Persönlichkeitsstörung“ könnte es künftig heißen: „Mittelschwere Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägter Dissozialität und Distanziertheit“.
Ziel dieses Modells ist eine präzisere und weniger stigmatisierende Diagnostik, die den unterschiedlichen Ausprägungen besser gerecht wird.
Ob es sich in der Praxis durchsetzt, bleibt abzuwarten. Während Kritiker vor höherem Aufwand und schlechter Vergleichbarkeit mit älteren Studien warnen, sehen Befürworter die Chance für individuellere Behandlungsansätze.
Dynamik zwischen Persönlichkeitsstörungen
Manche Persönlichkeitsmuster wirken wie Gegensätze, die sich anziehen – sie ergänzen sich auf eine Weise, die für beide Beteiligten ungesund ist. Besonders oft sieht man dies zwischen Cluster-B- und Cluster-C-Persönlichkeiten.
So kann sich etwa eine narzisstische Persönlichkeit mit einem abhängigen Partner verbinden. Der eine braucht ständige Bewunderung, der andere stellt die eigenen Bedürfnisse zurück – und beide verfestigen dadurch unbewusst ihre jeweiligen Muster.
Ähnliches findet man bei Borderline und ängstlich-vermeidender Persönlichkeit: Die Angst vor Verlassenwerden trifft auf die Angst vor Konflikten. Einer explodiert, der andere weicht zurück – und so wiederholt sich der Kreislauf.
Auch die Kombination von histrionischen und zwanghaften Persönlichkeiten kann eine solche Spannung erzeugen: Dramatik trifft auf Kontrolle, beide stabilisieren sich gegenseitig in ihrem Extrem.
Diese Dynamiken sind häufig erstaunlich stabil – selbst wenn beide Partner darunter leiden. Die Verhaltensmuster nähren sich gegenseitig, sodass ein Kreislauf entsteht, der oft über Jahre bestehen bleibt.
Solche Beobachtungen sind keine festen Regeln, sondern typische Muster. Sie können helfen, wiederkehrende Schwierigkeiten in Beziehungen besser zu verstehen.
Allgemeine Persönlichkeitsstörungen – Die Grundvoraussetzung für eine Diagnose
Bevor eine Cluster-B-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden kann, prüfen Fachleute zunächst, ob die allgemeinen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung überhaupt erfüllt sind.
Erst dann wird genauer unterschieden – etwa zwischen narzisstischer, Borderline-, histrionischer oder dissozialer Ausprägung.
Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen Persönlichkeitsstil und Persönlichkeitsstörung. Nicht jede auffällige Persönlichkeit ist gleich krankhaft. Der Übergang ist fließend:
- Persönlichkeitsstil: Ein Manager mit narzisstischen Zügen kann durchaus erfolgreich sein. Sein Charisma und seine Zielstrebigkeit öffnen Türen. Solange er Beziehungen stabil gestalten und sein Verhalten anpassen kann, bleibt es ein Stil – nicht mehr.
- Persönlichkeitsstörung: Wenn derselbe Manager keine Kritik erträgt, Mitarbeitende systematisch abwertet, seine Familie belastet und sein Verhalten trotz negativer Konsequenzen nicht ändern kann, spricht man von einer Störung.
Das entscheidende Kriterium ist also nicht, ob jemand auffällig wirkt, sondern ob ein echter Leidensdruck und Funktionsbeeinträchtigungen entstehen – und zwar in mehreren Lebensbereichen wie Arbeit, Beziehungen oder Freizeit.
Bitte keine Selbst- oder Fremddiagnosen
Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und dem besseren Verständnis von Persönlichkeitsstörungen. Sie ersetzen keine professionelle Diagnose. Eine fundierte Diagnose kann nur durch ausgebildete Fachkräfte wie Psychiater oder klinische Psychologen nach ausführlicher Untersuchung gestellt werden. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungsbilder mit vielen Überschneidungen. Viele Symptome können auch andere Ursachen haben – von Stress über Depression bis zu körperlichen Erkrankungen. Eine Fehleinschätzung kann mehr schaden als nutzen. Nutze das Wissen als Orientierungshilfe, um problematische Verhaltensmuster besser einzuordnen. Wenn du vermutest, dass jemand in deinem Umfeld betroffen sein könnte, betrachte dies als Arbeitshypothese – nicht als feststehende Tatsache. Bei ernsthaften Belastungen oder Gefährdungssituationen such dir professionelle Unterstützung. Das gilt sowohl für den Umgang mit möglicherweise betroffenen Personen als auch für deine eigene psychische Gesundheit.
Wie häufig sind Persönlichkeitsstörungen?
Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 10 Prozent der Bevölkerung von einer Persönlichkeitsstörung betroffen. Diese Zahl umfasst alle Störungsbilder von Cluster A bis C.
Innerhalb dieser Gesamtgruppe entfällt nur ein kleiner Teil auf die einzelnen Störungen. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung wird in Studien zum Beispiel mit einer Häufigkeit von etwa 1–2 % der Bevölkerung angegeben.
Diagnosekriterien laut DSM-5
Laut DSM-5, dem diagnostischen Handbuch für psychische Störungen, müssen für die Diagnose einer allgemeinen Persönlichkeitsstörung folgende Bedingungen erfüllt sein:
Cluster-A- und Cluster-C-Persönlichkeitsstörungen – Die anderen beiden Gruppen
Neben den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen unterscheidet man zwei weitere Cluster, die jeweils durch ganz eigene Merkmale geprägt sind:
Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen – Die „exzentrischen“ Typen
Menschen mit Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen wirken auf andere oft sonderbar, misstrauisch oder sehr distanziert. Sie ziehen sich in ihre eigene Gedankenwelt zurück und haben dadurch häufig Schwierigkeiten, stabile soziale Beziehungen aufzubauen.
Zu diesem Cluster gehören:
- Paranoide Persönlichkeitsstörung – tiefes Misstrauen, ständige Wachsamkeit und die Tendenz, überall Feinde zu sehen.
- Schizoide Persönlichkeitsstörung – emotionale Distanziertheit, wenig Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen.
- Schizotypische Persönlichkeitsstörung – exzentrisches Verhalten, ungewöhnliche Denkweisen und oft paranoide Tendenzen.
Während Menschen mit Cluster-A-Störungen oft als sonderbar und distanziert wahrgenommen werden, spiegelt dies vor allem ihre Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen wider – nicht zwangsläufig mangelndes Interesse oder böse Absicht.
Cluster-C-Persönlichkeitsstörungen – Die „ängstlichen“ Typen
Cluster-C-Persönlichkeitsstörungen sind geprägt von ausgeprägter Unsicherheit, Ängstlichkeit und einer starken Abhängigkeit von anderen.
Betroffene kämpfen häufig mit sozialem Rückzug, perfektionistischen Ansprüchen oder einem übersteigerten Bedürfnis nach Schutz und Bestätigung.
Zu diesem Cluster gehören:
- Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung – extreme soziale Unsicherheit, Angst vor Ablehnung, Rückzug aus Angst vor Kritik.
- Asthenische (abhängige) Persönlichkeitsstörung – übermäßige Bedürftigkeit, Angst vor Alleinsein, starke Unterordnung unter andere.
- Anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung – Perfektionismus, starres Bedürfnis nach Kontrolle, Angst vor Fehlern.
Während Menschen mit Cluster-B-Störungen oft dominant und impulsiv wirken, zeichnen sich Cluster-C-Persönlichkeiten eher durch Zurückhaltung, Unsicherheit und Ängstlichkeit aus.
Fazit: Persönlichkeitsstörungen verstehen – aber richtig!
Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungsbilder. Sie entstehen nicht durch einen einzelnen Faktor, sondern durch das Zusammenspiel von genetischer Veranlagung, Erziehung, Umweltbedingungen und individuellen Lebenserfahrungen.
Besonders die Cluster-B-Störungen gelten als herausfordernd – für Betroffene selbst ebenso wie für ihr Umfeld. Sie sind häufig verbunden mit Manipulationstendenzen, emotionaler Instabilität und deutlichen Defiziten in der Empathie.
Was bedeutet das konkret?
Das Verständnis dieser Störungsbilder ermöglicht eine bessere Einordnung problematischer Verhaltensweisen. Wichtige Erkenntnisse für den Umgang:
- Grenzen der Veränderbarkeit: Persönlichkeitsstörungen sind tief verankerte Muster. Die Erfolgsquote therapeutischer Interventionen ist besonders bei Cluster-B-Störungen begrenzt. Bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung gelten die Behandlungsaussichten als sehr gering – manche Fachleute sprechen hier sogar von nahezu aussichtslos.
- Selbstschutz hat Priorität: In Beziehungen mit Cluster-B-Persönlichkeiten sind klare Grenzen oder professionelle Distanz oft die einzige wirksame Strategie. Das Umfeld kann die Störung nicht „heilen“ oder durch Verständnis auflösen.
- Mustererkennung: Wer typische Dynamiken kennt – etwa Love Bombing beim Narzissten, Spaltung bei Borderline oder dramatische Inszenierungen bei der histrionischen Störung – kann früher reagieren und sich schützen.
- Professionelle Hilfe: Bei Verdacht auf eine Persönlichkeitsstörung ist fachliche Diagnostik wichtig. Selbst- oder Laiendiagnosen sind problematisch und führen oft in die Irre.
Die Auseinandersetzung mit Persönlichkeitsstörungen dient in erster Linie dem Verständnis und dem Selbstschutz – nicht der Veränderung der betroffenen Person.
Tiefer eintauchen
Wenn dich die fachliche Perspektive interessiert, findest du hier weitere Fachartikel zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen:
Narzissten: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.8)
Psychopathen: Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.2)
Borderliner: Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.31)
Histrioniker: Die histrionische Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.4)
Literatur:
*1 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5, Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, S. 885f., Hogrefe GmbH & Co. KG, 2. korrigierte Auflage 2018