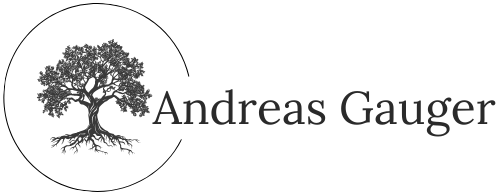Ein Bindungstrauma kann das ganze Leben beeinflussen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Beziehungen verlaufen nach denselben schmerzhaften Mustern, Vertrauen fällt schwer, und Nähe kann genauso beängstigend sein wie das Alleinsein.
Viele Menschen denken, sie hätten "einfach Pech" in der Liebe oder müssten sich nur endlich "richtig entscheiden". Doch oft liegt die Ursache viel tiefer – in den Bindungserfahrungen der ersten Lebensjahre.
Bindungstrauma entsteht, wenn die früheste und wichtigste Form von Beziehung – die zu unseren primären Bezugspersonen – von Unsicherheit, Zurückweisung oder emotionaler Unberechenbarkeit geprägt ist. Was ein Kind in den ersten Jahren erlebt, prägt sein neurobiologisches Bindungssystem für das gesamte Leben.
In diesem Artikel erfährst du:
- Was Bindungstrauma aus wissenschaftlicher Sicht ist
- Wie sich die vier Bindungsstile entwickeln und manifestieren
- Welche neurobiologischen Prozesse dabei ablaufen
- Was die Forschung über Heilungsmöglichkeiten sagt
Was ist ein Bindungstrauma?
Ein Bindungstrauma ist eine tiefgreifende Störung des Bindungssystems, die entsteht, wenn ein Kind in den ersten Lebensjahren keine sichere emotionale Basis entwickeln kann.
Im Gegensatz zu einem einmaligen Schocktrauma handelt es sich um ein Entwicklungstrauma – eine Anpassung an chronisch unsichere Beziehungserfahrungen.
Die Bindungsforschung, begründet durch John Bowlby und Mary Ainsworth, zeigt: Menschen sind biologisch darauf programmiert, sichere emotionale Verbindungen zu ihren Bezugspersonen aufzubauen.
Dieses Bindungssystem ist überlebenswichtig – es sichert nicht nur physischen Schutz, sondern reguliert auch Stress, Emotionen und die Entwicklung des Selbst.
Die neurobiologische Dimension
Wenn die primären Bezugspersonen emotional nicht verfügbar, unberechenbar oder bedrohlich sind, passt sich das kindliche Gehirn an diese Realität an.
Der Neurobiologe Allan Schore beschreibt, wie wiederholte Erfahrungen von Bindungsunsicherheit die Entwicklung der rechten Gehirnhälfte beeinträchtigen – genau jener Bereich, der für Emotionsregulation und zwischenmenschliche Verbindung zuständig ist.
Diese frühen Anpassungen manifestieren sich in:
- Veränderter Stressregulation: Chronisch erhöhte oder abgeflachte Cortisolspiegel
- Dysreguliertem Nervensystem: Überaktivierung (Hyperarousal) oder Untererregung (Hypoarousal)
- Veränderten neuronalen Netzwerken: Besonders in Amygdala, Hippocampus und präfrontalem Kortex
Abgrenzung zu verwandten Konzepten
Bindungstrauma ≠ Bindungsstörung (ICD-10: F94.1/F94.2): Bindungsstörungen sind klinische Diagnosen bei Kindern mit schweren Beeinträchtigungen. Bindungstrauma ist breiter gefasst und kann auch subtilere Formen umfassen.
Bindungstrauma ≠ Einzeltrauma: Während ein Einzeltrauma (Unfall, Gewalt) zu einer PTBS führen kann, entsteht Bindungstrauma durch kumulative Beziehungserfahrungen über Jahre.
Bindungstrauma → Entwicklungstrauma: Der Begriff Entwicklungstrauma (Bessel van der Kolk) beschreibt die umfassenden Auswirkungen früher Traumatisierung auf alle Entwicklungsbereiche.
Die vier Bindungsstile: Wie frühe Muster unser Leben prägen
Die Bindungsforschung identifiziert vier grundlegende Bindungsstile, die sich in der frühen Kindheit entwickeln und bis ins Erwachsenenalter wirken. Diese Muster entstehen als Anpassungsstrategien an die verfügbare Fürsorge.
1. Sichere Bindung (ca. 60% der Bevölkerung)
Entsteht, wenn Bezugspersonen konsistent verfügbar und feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Diese Menschen entwickeln ein positives Selbst- und Fremdbild: "Ich bin liebenswert, andere sind vertrauenswürdig."
2. Unsicher-vermeidende Bindung (ca. 20%)
Entwickelt sich bei emotional distanzierten oder zurückweisenden Bezugspersonen. Das Kind lernt: Selbstständigkeit ist sicherer als Abhängigkeit. Im Erwachsenenalter zeigt sich oft emotionale Distanz und Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen.
3. Unsicher-ambivalente Bindung (ca. 15%)
Entsteht durch inkonsistente Fürsorge – mal überfürsorglich, mal abweisend. Das Kind entwickelt eine Hyperaktivierung des Bindungssystems: ständige Wachsamkeit, ob die Bindungsperson verfügbar ist. Später zeigen sich oft Verlustängste und emotionale Abhängigkeit.
4. Desorganisierte Bindung (ca. 5-10%)
Die schwerwiegendste Form, oft verbunden mit Trauma oder schwerer Vernachlässigung. Die Bindungsperson ist gleichzeitig Quelle von Sicherheit und Gefahr – ein unlösbares Dilemma für das Kind.
Main und Hesse (1990) beschreiben dies als "Angst ohne Lösung". Im Erwachsenenalter zeigen sich oft Symptome einer Komplexen PTBS oder Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Wichtig: Bindungsstile sind veränderbar
Die Forschung zeigt: Etwa 30% der Menschen verändern ihren Bindungsstil im Laufe des Lebens durch korrigierende Beziehungserfahrungen. Das Konzept der "earned secure attachment" (erarbeitete sichere Bindung) belegt, dass Heilung möglich ist.
Wie Bindungstrauma das Gehirn verändert
Bindungstrauma hinterlässt messbare Spuren im Gehirn. Die moderne Neurowissenschaft kann heute zeigen, wie frühe Beziehungserfahrungen unsere neuronale Architektur formen.
Die kritischen Entwicklungsfenster
Karl Heinz Brisch, einer der führenden Bindungsforscher, beschreibt, dass sich unsere frühesten Erfahrungen direkt in unsere biologischen Stress- und Regulationssysteme einschreiben.
In den ersten drei Lebensjahren durchläuft das Gehirn eine explosionsartige Entwicklung.
Besonders die rechte Gehirnhälfte, zuständig für Emotionsregulation und Bindung, ist in dieser Phase hochsensibel für zwischenmenschliche Erfahrungen. Allan Schore (2019) bezeichnet dies als das "Fenster der Bindungsprägung".
Während dieser kritischen Phase entwickeln sich:
- Die orbitofrontale Region (Impulskontrolle und Emotionsregulation)
- Das limbische System (emotionales Gedächtnis und Stressreaktion)
- Die Verbindungen zwischen Kortex und Stammhirn (Integration von Denken und Fühlen)
Neurobiologische Folgen von Bindungstrauma
Bei Kindern mit Bindungstrauma zeigen bildgebende Verfahren charakteristische Veränderungen:
Vergrößerte Amygdala:
Das "Alarmzentrum" des Gehirns ist überaktiv. Betroffene reagieren intensiver auf potenzielle Bedrohungen – auch in objektiv sicheren Situationen.
Reduziertes Hippocampus-Volumen:
Der für Gedächtnis und Kontextualisierung zuständige Bereich schrumpft durch chronischen Stress. Dies erklärt, warum traumatische Erinnerungen oft fragmentiert und überwältigend bleiben.
Beeinträchtigter präfrontaler Kortex:
Die "Kontrollzentrale" für rationales Denken und Emotionsregulation ist weniger aktiv. Betroffene haben Schwierigkeiten, intensive Gefühle zu regulieren oder impulsive Reaktionen zu kontrollieren.
Dysregulierte HPA-Achse:
Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, unser zentrales Stresssystem, ist dauerhaft verstellt. Manche Betroffene zeigen chronisch erhöhte Cortisolwerte (ständige Alarmbereitschaft), andere paradoxerweise erniedrigte Werte (emotionale Taubheit).
Die Polyvagal-Theorie und Bindungstrauma
Stephen Porges' Polyvagal-Theorie erklärt, warum Bindungstrauma so tiefgreifende Auswirkungen hat. Unser autonomes Nervensystem hat drei Reaktionsebenen:
- Soziales Engagement (ventraler Vagus): Sicherheit und Verbindung
- Kampf/Flucht (Sympathikus): Mobilisierung bei Gefahr
- Erstarrung (dorsaler Vagus): Totstellreflex bei Überwältigung
Bei sicherer Bindung lernt das Kind, flexibel zwischen diesen Zuständen zu wechseln. Bei Bindungstrauma bleibt das System oft in Alarmbereitschaft oder Erstarrung gefangen – selbst in sicheren Situationen.
Bindungstrauma durch narzisstische Eltern
Wenn primäre Bezugspersonen narzisstische Persönlichkeitszüge aufweisen, entsteht eine besonders destruktive Form des Bindungstraumas. Das Kind wächst in einem Umfeld auf, in dem Liebe konditioniert und instrumentalisiert wird.
Spezifische Dynamik bei narzisstischen Eltern
Narzisstische Eltern sehen ihre Kinder primär als Erweiterung ihres eigenen Selbst oder als Quelle narzisstischer Zufuhr.
Das Kind existiert, um die Bedürfnisse des Elternteils zu erfüllen – sei es als Trophäe, die man vorzeigen kann, als emotionaler Therapeut oder als Sündenbock für eigene Unzulänglichkeiten. Die eigenen Bedürfnisse des Kindes werden dabei systematisch übergangen oder als störend empfunden.
Diese Eltern spiegeln nur jene Aspekte des Kindes, die ihr eigenes Selbstbild stärken. Ein Kind lernt schnell: "Ich bin nur wertvoll, wenn ich funktioniere."
Gleichzeitig übernimmt es oft die emotionale Verantwortung für den Elternteil – eine Parentifizierung, die das kindliche Nervensystem überfordert und eine gesunde Entwicklung verhindert. Besonders zerstörerisch ist das systematische Anzweifeln der kindlichen Wahrnehmung.
"Das war nicht so gemeint" oder "Du bist zu empfindlich" werden zu Standardantworten auf emotionale Bedürfnisse, bis das Kind seiner eigenen Realität nicht mehr traut.
Diese Dynamiken hinterlassen tiefe neurobiologische Spuren. Das Kind entwickelt eine Hypervigilanz – es scannt ständig die Umgebung nach Stimmungsschwankungen des Elternteils.
Da nur "erwünschte" Anteile gespiegelt wurden, entsteht kein kohärentes Selbst, sondern eine fragmentierte Identität. Die Botschaft "Mit mir stimmt etwas nicht" wird so tief internalisiert, dass chronische Schamgefühle zur Grundmelodie des Lebens werden.
Wie Bindungstraumata über Generationen weitergegeben werden
Die Forschung von Fraiberg und Kollegen (1975) zeigt in ihrer bahnbrechenden Studie "Ghosts in the Nursery":
Etwa 30% der traumatisierten Kinder geben ihre Traumata an die nächste Generation weiter. Bei narzisstischem Missbrauch ist diese Rate oft höher, da die Betroffenen keine sicheren Bindungsmodelle entwickeln konnten.
Doch die Mehrheit – die anderen 70% – durchbricht den Kreislauf. Diese "Transmission Gap" entsteht durch verschiedene Schutzfaktoren:
Das Bewusstsein über die eigene Geschichte spielt eine zentrale Rolle. Wer versteht, was geschehen ist, kann bewusst anders handeln.
Korrigierende Beziehungserfahrungen – sei es mit einem Partner, Freunden oder in der Therapie – zeigen, dass Bindung auch anders funktionieren kann. Oft reicht schon eine einzige sichere Bindung im Leben, um das innere Arbeitsmodell von Beziehungen zu verändern.
Co-Parenting mit einem narzisstischen Ex-Partner
Besonders herausfordernd wird es, wenn man gemeinsame Kinder mit einem narzisstischen Ex-Partner hat. Das Kind ist dann zwei gegensätzlichen Bindungswelten ausgesetzt – einer, in der es bedingungslos angenommen wird, und einer, in der es funktionieren muss.
Der gesunde Elternteil kann zum emotionalen Anker werden. Durch verlässliche emotionale Verfügbarkeit schafft er ein Gegengewicht zur Unberechenbarkeit.
Wichtig ist dabei, die Realität des Kindes zu validieren, ohne den anderen Elternteil zu dämonisieren. Sätze wie "Ich verstehe, dass dich das verwirrt" helfen mehr als "Dein Vater/deine Mutter ist gestört".
Die Stärkung der kindlichen Selbstwahrnehmung wird zur Schutzimpfung gegen Manipulation. Fragen wie "Was fühlst du?" oder "Was denkst du darüber?" geben dem Kind den Raum, seine eigene Wahrheit zu finden – jenseits dessen, was der narzisstische Elternteil hören will.
Mehr dazu erfährst du hier: Gemeinsame Kinder mit einem Narzissten – Co-Parenting zwischen Manipulation und Grenzsetzung
Wenn Bindungstrauma zur Komplexen PTBS wird
Nicht jedes Bindungstrauma führt zu einer klinischen Störung. Viele Menschen entwickeln Bewältigungsstrategien, die ihnen ein funktionales Leben ermöglichen. Doch wenn die frühe emotionale Unsicherheit besonders schwerwiegend war oder sich mit weiteren traumatischen Erfahrungen verbindet, kann sich eine Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (KPTBS) entwickeln.
Der Unterschied zwischen PTBS und KPTBS
Die klassische PTBS entsteht typischerweise durch ein einzelnes, überwältigendes Ereignis – einen Unfall, einen Überfall, eine Naturkatastrophe. Die Symptome kreisen um dieses spezifische Trauma:
Flashbacks, Vermeidung, Übererregung. Die Komplexe PTBS hingegen entsteht durch anhaltende, wiederholte Traumatisierung, besonders in Beziehungen, denen man nicht entkommen kann.
Judith Herman, die den Begriff prägte, beschreibt KPTBS als Folge von "prolongiertem, wiederholtem Trauma unter Bedingungen der Gefangenschaft" – wobei Gefangenschaft auch emotionaler Natur sein kann, wie in einer Familie, der ein Kind nicht entfliehen kann.
Die WHO hat KPTBS 2018 in die ICD-11 aufgenommen (6B41) und definiert drei Kernbereiche, die über die klassische PTBS hinausgehen: schwere Störungen der Emotionsregulation, ein durchgehend negatives Selbstkonzept und massive Beziehungsstörungen.
Die neurobiologische Signatur der KPTBS
Menschen mit KPTBS zeigen charakteristische Gehirnveränderungen, die über jene der klassischen PTBS hinausgehen.
Das Default Mode Network (DMN) – jenes Netzwerk, das aktiv ist, wenn wir über uns selbst nachdenken – ist fundamental verändert. Statt eines kohärenten Selbstbildes zeigt sich eine fragmentierte Aktivierung, die das Gefühl eines "zerrissenen Selbst" neurobiologisch abbildet.
Besonders betroffen ist auch das Fenstер der Toleranz – jener Bereich, in dem wir Stress bewältigen können, ohne in Über- oder Untererregung zu kippen. Bei Menschen mit KPTBS ist dieses Fenster extrem schmal.
Kleinste Trigger können zu massiver Überflutung führen, während sie in anderen Momenten in emotionaler Taubheit versinken. Diese Dysregulation ist keine "Schwäche", sondern eine messbare Veränderung der neuronalen Stressverarbeitung.
Die Forschung von Judith Hermann, Bessel van der Kolk und Kollegen zeigt zudem, dass bei KPTBS die Zeitverarbeitung im Gehirn gestört ist. Traumatische Erinnerungen werden nicht als "vergangen" abgespeichert, sondern bleiben im emotionalen Gehirn präsent.
Betroffene erleben keine Flashbacks im klassischen Sinn, sondern leben in einem zeitlosen Zustand der Bedrohung – als wäre die unsichere Kindheit nie vorbei.
Bindungstrauma als Risikofaktor
Nicht jedes Bindungstrauma führt zu KPTBS, aber es erhöht das Risiko signifikant. Besonders die desorganisierte Bindung – bei der das Kind keine kohärente Strategie entwickeln konnte – korreliert stark mit späteren KPTBS-Symptomen.
Die Studie von Lyons-Ruth und Kollegen (2006) fand, dass 80% der Kinder mit desorganisierter Bindung im Erwachsenenalter Symptome einer Traumafolgestörung zeigen.
Der Mechanismus dahinter: Ein Kind mit sicherer Bindung entwickelt die Fähigkeit zur Selbstregulation durch Co-Regulation. Es lernt, überwältigende Gefühle mit Hilfe der Bezugsperson zu bewältigen und internalisiert diese Fähigkeit.
Ein Kind mit Bindungstrauma muss sich selbst regulieren – eine Aufgabe, für die sein unreifes Nervensystem nicht ausgestattet ist. Diese frühe Überforderung hinterlässt ein dysreguliertes System, das anfällig für weitere Traumatisierungen bleibt.
Heilung von Bindungstrauma: Was die Forschung zeigt
Die zentrale Erkenntnis der modernen Traumaforschung ist hoffnungsvoll:
Bindungstrauma ist heilbar. Das Gehirn behält seine Neuroplastizität ein Leben lang – die Fähigkeit, neue neuronale Verbindungen zu bilden und alte Muster zu überschreiben.
Die Paradoxie der Heilung
"Was in Beziehungen verwundet wurde, kann nur in Beziehungen heilen" – dieser Satz von Bruce Perry trifft den Kern.
Das Bindungssystem wurde durch zwischenmenschliche Erfahrungen geprägt und braucht korrigierende zwischenmenschliche Erfahrungen zur Heilung.
Doch genau hier liegt die Herausforderung: Menschen mit Bindungstrauma haben gelernt, dass Beziehungen gefährlich sind. Sie sollen sich ausgerechnet dort öffnen, wo ihre tiefsten Wunden liegen.
Diese Paradoxie löst sich durch schrittweise, dosierte Erfahrungen von Sicherheit in Beziehungen. Das kann in der Therapie beginnen, wo der sichere Rahmen es ermöglicht, neue Bindungserfahrungen zu machen.
Die Forschung zeigt, dass die therapeutische Beziehung – die Qualität der Verbindung zwischen Therapeut und Klient – der wichtigste Faktor für den Therapieerfolg ist, wichtiger als die spezifische Methode.
Therapieansätze, die nachweislich helfen
Die Traumaforschung hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene Ansätze entwickelt, die spezifisch auf Bindungstrauma ausgerichtet sind.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) hilft, traumatische Erinnerungen neu zu verarbeiten, indem bilaterale Stimulation die Integration zwischen den Gehirnhälften fördert.
Studien zeigen Erfolgsraten von 70-90% bei PTBS-Symptomen, wobei die Wirksamkeit bei KPTBS noch erforscht wird.
Die Somatic Experiencing Methode von Peter Levine arbeitet direkt mit dem Körpergedächtnis. Da Bindungstrauma oft vorsprachlich entstanden ist, reicht kognitives Verstehen nicht aus – der Körper muss lernen, dass die Gefahr vorbei ist.
Durch achtsame Körperwahrnehmung und das Pendeln zwischen Anspannung und Entspannung wird das Nervensystem schrittweise reguliert.
Besonders vielversprechend sind bindungsbasierte Therapien wie die Emotionsfokussierte Therapie (EFT) oder die auf Mentalisierung basierende Therapie (MBT).
Diese Ansätze arbeiten direkt an der Fähigkeit, sichere Bindungen aufzubauen und mentale Zustände – eigene und fremde – zu verstehen. Die Studien von Fonagy und Kollegen zeigen, dass sich durch MBT nicht nur Symptome reduzieren, sondern sich tatsächlich der Bindungsstil verändern kann.
Die Rolle des Körpers
Bessel van der Kolk's berühmter Ausspruch "The Body Keeps the Score" unterstreicht: Bindungstrauma sitzt im Körper.
Chronische Verspannungen, Verdauungsprobleme oder Autoimmunerkrankungen können Ausdruck unverarbeiteter früher Erfahrungen sein.
Körperorientierte Ansätze wie Yoga, Tai Chi oder traumasensitives Yoga zeigen in Studien signifikante Verbesserungen der Emotionsregulation und Reduktion von PTBS-Symptomen.
Die Polyvagal-informierte Therapie arbeitet direkt mit dem autonomen Nervensystem. Durch Vagusnerv-Stimulation – sei es durch Atemübungen, Singen oder soziale Interaktion – wird der ventrale Vagus aktiviert, jener Teil, der für Sicherheit und soziale Verbindung zuständig ist.
Die Forschung von Porges und Kollegen zeigt, dass regelmäßige Vagusnerv-Stimulation die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress nachhaltig erhöht.
Earned Secure Attachment: Der Weg zur sicheren Bindung
Das Konzept der "erarbeiteten sicheren Bindung" ist revolutionär: Menschen können trotz unsicherer oder traumatischer Kindheitserfahrungen eine sichere Bindung entwickeln.
Die Langzeitstudie von Roisman und Kollegen (2002) fand, dass etwa 30% der unsicher gebundenen Kinder im Erwachsenenalter sichere Bindungsmuster zeigen.
Was macht den Unterschied? Drei Faktoren scheinen besonders wichtig:
Erstens die Fähigkeit, die eigene Geschichte zusammenhängend zu erzählen – es geht nicht darum, keine schlimmen Erfahrungen gemacht zu haben, sondern darum, sie einordnen und darüber reflektieren zu können.
Zweitens mindestens eine sichere Beziehung im Leben – sei es zu einem Großelternteil, Lehrer oder späteren Partner.
Drittens die Fähigkeit zur Mentalisierung – das bedeutet, verstehen zu können, was in einem selbst und in anderen vorgeht, welche Gefühle und Gedanken das Verhalten beeinflussen.
Fazit: Die Hoffnung der Neuroplastizität
Bindungstrauma prägt uns auf der tiefsten Ebene unseres Seins. Es formt, wie wir Beziehungen erleben, wie unser Nervensystem auf Nähe reagiert, und welche Partner wir unbewusst wählen. Diese frühen Prägungen sind mächtig – aber sie sind nicht unumkehrbar.
Die moderne Neurowissenschaft zeigt: Unser Gehirn bleibt lebenslang formbar.
Die gleiche Plastizität, die es dem kindlichen Gehirn ermöglichte, sich an unsichere Bedingungen anzupassen, ermöglicht es dem erwachsenen Gehirn, neue Wege zu bahnen.
Sichere Bindungserfahrungen können auch im Erwachsenenalter erworben werden – durch Therapie, durch korrigierende Beziehungen, durch bewusste Arbeit an den eigenen Mustern.
Der Weg ist nicht einfach. Er führt direkt durch die alten Wunden hindurch, konfrontiert uns mit tief sitzenden Ängsten und fordert uns heraus, genau dort Vertrauen zu wagen, wo wir am verletzlichsten sind.
Doch die Forschung ist eindeutig: Heilung ist möglich. Nicht nur Symptomlinderung, sondern echte Transformation des Bindungssystems.
Für viele beginnt dieser Weg mit dem Verstehen der eigenen Geschichte. Zu erkennen, dass die eigenen Beziehungsmuster nicht "Charakterfehler" sind, sondern Anpassungsleistungen eines Kindes, das überleben musste.
Diese Erkenntnis allein kann befreiend wirken und den Raum für Veränderung öffnen.
Tiefer eintauchen
Hier findest du weiterführende Artikel zu angrenzenden Themen:
Trauma Bonding: Wenn loslassen unmöglich scheint – und wie es doch gelingt
Entwicklungstrauma: Die unsichtbare Epidemie unserer Zeit
Literatur / Quellen:
*Bowlby, J. (2010). Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. Reinhardt Verlag.
*Bowlby, J. (2016). Frühe Bindung und kindliche Entwicklung. Reinhardt Verlag.
*Ainsworth, M. D. S. & Bell, S. M. (2003). Mutter-Kind-Bindung und soziale Entwicklung. In Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (Hrsg.), Bindung und menschliche Entwicklung. Klett-Cotta.
*Brisch, K. H. (2019). Bindungsstörungen: Von der Bindungstheorie zur Therapie (16. Auflage). Klett-Cotta.
*Brisch, K. H. (2017). SAFE® - Sichere Ausbildung für Eltern. Klett-Cotta.
*Schore, A. N. (2007). Affektregulation und die Reorganisation des Selbst. Klett-Cotta.
*van der Kolk, B. (2015). Verkörperter Schrecken: Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Probst Verlag.
*Porges, S. W. (2017). Die Polyvagal-Theorie: Neurophysiologische Grundlagen der Therapie. Junfermann Verlag.
*Perry, B. D. & Szalavitz, M. (2008). Der Junge, der wie ein Hund gehalten wurde: Was traumatisierte Kinder uns über Leid, Liebe und Heilung lehren können. Kösel Verlag.
*Herman, J. L. (2018). Die Narben der Gewalt: Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden (5. Auflage). Junfermann Verlag.
*Levine, P. A. (2011). Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt. Kösel Verlag.
*Levine, P. A. (2016). Trauma und Gedächtnis: Die Spuren unserer Erinnerung in Körper und Gehirn. Kösel Verlag.
*Fonagy, P. & Bateman, A. (2019). Handbuch mentalisierungsbasierte Therapie. Vandenhoeck & Ruprecht.
*Ruppert, F. (2018). Trauma, Bindung und Familienstellen: Seelische Verletzungen verstehen und heilen. Klett-Cotta