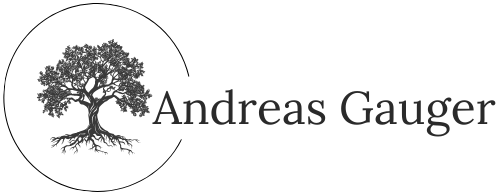Manche Menschen können nach Stress einfach abschalten. Andere bleiben innerlich aufgewühlt – selbst wenn die Gefahr längst vorbei ist. Der Unterschied liegt nicht im Charakter, sondern im autonomen Nervensystem.
Wer Trauma, chronischen Stress oder emotionale Vernachlässigung erlebt hat, kennt das Gefühl: Der Körper reagiert, bevor der Verstand eingreifen kann. Plötzliche Panik in harmlosen Situationen. Wutausbrüche, die unverhältnismäßig erscheinen. Oder eine lähmende Leere, selbst in Momenten, die eigentlich schön sein sollten.
Diese Reaktionen sind keine "Überempfindlichkeit" oder "Schwäche". Sie sind neurobiologische Muster, die sich tief ins Nervensystem eingegraben haben. Die Polyvagaltheorie von Stephen Porges erklärt, warum manche Menschen in ständiger Alarmbereitschaft leben – und wie man diese alten Programme durchbrechen kann.
In diesem Artikel erfährst du:
- Wie das autonome Nervensystem funktioniert und warum es drei (nicht zwei) Zustände gibt
- Woran du erkennst, in welchem Zustand du dich befindest
- Konkrete Techniken zur Nervensystem-Regulation
- Warum Selbstregulation bei Trauma an Grenzen stößt – und wann professionelle Begleitung nötig wird
Was ist Selbstregulation?
Selbstregulation ist die Fähigkeit, die eigenen emotionalen und körperlichen Zustände zu beeinflussen – auch wenn äußere Umstände stressig sind.
Es geht nicht darum, Gefühle zu unterdrücken oder "immer positiv" zu sein. Es geht darum, flexibel zwischen verschiedenen Zuständen wechseln zu können.
Menschen mit guter Selbstregulation können sich aufregen – und wieder beruhigen. Sie können traurig sein – und wieder Freude empfinden.
Sie können Angst haben – und trotzdem handlungsfähig bleiben. Ihr Nervensystem ist wie ein gut gestimmtes Instrument, das auf verschiedene Situationen angemessen reagiert.
Bei Menschen mit Trauma oder chronischem Stress ist dieses System oft dysreguliert – es bleibt in extremen Zuständen hängen.
Entweder in ständiger Übererregung (immer auf der Hut, schnell reizbar, schlaflos) oder in Untererregung (emotional taub, erschöpft, wie abgeschnitten). Der flexible Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung funktioniert nicht mehr.
Die Polyvagaltheorie: Ein neues Verständnis des Nervensystems
Jahrzehntelang dachte man, das autonome Nervensystem hätte nur zwei Modi: Kampf/Flucht (Stress) oder Ruhe/Verdauung (Entspannung).
Stephen Porges revolutionierte dieses Verständnis mit seiner Polyvagaltheorie (1994). Er entdeckte, dass wir nicht zwei, sondern drei Nervensystem-Zustände haben.
Die drei Zustände des autonomen Nervensystems
1. Soziale Verbindung (Ventraler Vagus)
Dies ist unser optimaler Zustand. Wenn der ventrale (vordere) Teil des Vagusnervs aktiv ist, fühlen wir uns sicher, verbunden und präsent.
Unser Gesicht ist ausdrucksstark, unsere Stimme melodisch, wir können Augenkontakt halten. In diesem Zustand können wir gleichzeitig entspannt und aufmerksam sein – ideal für Lernen, Kreativität und Beziehungen.
Körperliche Zeichen: Ruhiger Herzschlag, tiefe Bauchatmung, entspannte Muskulatur, warme Hände, gute Verdauung.
2. Mobilisierung (Sympathikus)
Wenn Gefahr droht, aktiviert sich unser Sympathikus – das System für Kampf oder Flucht. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol fluten den Körper.
Das Herz rast, die Muskeln spannen sich an, die Sinne werden scharf. In akuten Gefahrensituationen ist das überlebenswichtig. Problematisch wird es, wenn wir chronisch in diesem Zustand bleiben.
Körperliche Zeichen: Erhöhter Puls, flache Brustatmung, Muskelanspannung, Schwitzen, erweiterte Pupillen, Verdauungsprobleme.
3. Erstarrung/Abschaltung (Dorsaler Vagus)
Wenn weder Kampf noch Flucht möglich sind, aktiviert sich der dorsale (hintere) Vagus – unser ältestes Überlebenssystem.
Der Körper fährt herunter, um Energie zu sparen und Schmerz zu minimieren. In extremen Situationen kann das lebensrettend sein. Doch viele Trauma-Betroffene bleiben in diesem Zustand gefangen.
Körperliche Zeichen: Verlangsamter Herzschlag, flache Atmung, Muskelschwäche, Kältegefühl, Benommenheit, emotionale Taubheit, Dissoziation (das Gefühl, "neben sich zu stehen").
Die Neurozeption: Unser unbewusster Gefahrendetektor
Porges prägte den Begriff "Neurozeption" für unsere unbewusste Einschätzung von Sicherheit oder Gefahr. Dieser Scan läuft permanent im Hintergrund – schneller als bewusstes Denken.
Bei Menschen mit Trauma ist diese Neurozeption oft fehlkalibriert: Sie wittern Gefahr, wo keine ist, oder erkennen echte Bedrohungen nicht.
Das erklärt, warum manche Menschen in harmlosen Situationen Panik bekommen (der Körper schreit "Gefahr!", obwohl objektiv alles sicher ist) oder warum andere in toxischen Beziehungen bleiben (der Körper erkennt die Gefahr nicht, weil Chaos "normal" geworden ist).
Woran du erkennst, in welchem Zustand du bist
Der erste Schritt zur Selbstregulation ist Bewusstsein. Du kannst nur verändern, was du wahrnimmst. Viele Menschen sind so an Dauerstress oder emotionale Taubheit gewöhnt, dass sie ihren Zustand gar nicht mehr bemerken.
Bin ich im Zustand der Sicherheit? (Ventraler Vagus)
In diesem Zustand fühlst du dich präsent und verbunden. Du kannst anderen in die Augen schauen, ohne dass es unangenehm wird. Deine Stimme hat einen natürlichen, melodischen Klang. Du atmest tief in den Bauch.
Dein Denken ist klar und flexibel – du kannst verschiedene Perspektiven einnehmen. Humor ist möglich. Du fühlst dich in deinem Körper "zu Hause".
Dieser Zustand ist nicht gleichbedeutend mit "immer glücklich". Du kannst auch traurig oder besorgt sein – aber du bleibst dabei reguliert. Die Gefühle überfluten dich nicht, sie fließen durch dich hindurch.
Bin ich in der Mobilisierung? (Sympathikus)
Hier bist du im Aktionsmodus. Dein Körper macht sich bereit zu kämpfen oder zu fliehen. Das Herz klopft schneller, die Atmung wird flacher und schneller.
Deine Muskeln spannen sich an – besonders Kiefer, Nacken und Schultern. Die Gedanken rasen oder kreisen um Probleme. Du bist reizbar, ungeduldig, kannst nicht stillsitzen. Schlaf wird schwierig.
In Maßen ist dieser Zustand normal und sogar nützlich – er gibt uns Energie für Herausforderungen. Problematisch wird es, wenn du nicht mehr herunterfahren kannst. Wenn jede E-Mail eine Stressreaktion auslöst. Wenn du auch im Urlaub angespannt bleibst.
Bin ich in der Erstarrung? (Dorsaler Vagus)
Dies ist der Zustand des Rückzugs und der Abschaltung. Du fühlst dich wie in Watte gepackt, emotional taub, von dir selbst getrennt. Entscheidungen fallen schwer, selbst kleine ("Was esse ich heute?").
Die Welt erscheint wie durch einen Schleier. Du hast keine Energie, fühlst dich schwer und träge. Soziale Interaktionen sind anstrengend bis unmöglich.
Viele verwechseln das mit Depression – und tatsächlich gibt es Überschneidungen. Aber während Depression eine Stimmungsstörung ist, ist dorsale Erstarrung eine Nervensystem-Reaktion. Der Körper hat auf "Spieltod" geschaltet.
Praktische Techniken zur Nervensystem-Regulation
Die folgenden Techniken zur Selbstregulation sind keine Zaubertricks, die sofort alles besser machen. Sie sind Übungswege, die dem Nervensystem neue Erfahrungen ermöglichen. Wichtig ist zu verstehen: Jeder Nervensystem-Zustand hat seine eigene Logik. Was in einem Zustand hilft, kann in einem anderen kontraproduktiv sein.
Wenn das System auf Hochtouren läuft: Der Weg aus der Übererregung
Wenn du im Sympathikus-Modus gefangen bist, kennst du das Gefühl: Dein Körper vibriert vor Anspannung, die Gedanken rasen, und selbst wenn du dich hinlegst, findest du keine Ruhe.
"Entspann dich doch mal" ist hier etwa so hilfreich wie "Sei doch nicht traurig" bei Depressionen. Das überreizte Nervensystem braucht konkrete, körperliche Signale, dass die Gefahr vorbei ist.
Die verlängerte Ausatmung ist eine der einfachsten und wirksamsten Techniken. Wenn wir länger ausatmen als einatmen, aktivieren wir direkt den Vagusnerv – jenen Teil des Nervensystems, der für Beruhigung zuständig ist.
Die 4-4-8-Atmung (4 Sekunden ein, 4 halten, 8 aus) ist dabei keine willkürliche Zahlenspielerei. Die lange Ausatmung sendet ein klares Signal: "Die Gefahr ist vorbei, wir können herunterfahren." Mindestens 10 Zyklen braucht es meist, bis der Körper beginnt zu reagieren.
Ein überraschend effektiver Weg ist kaltes Wasser. Wenn kaltes Wasser unser Gesicht trifft, aktiviert sich ein uralter Reflex – der Tauchreflex.
Sofort verlangsamt sich der Herzschlag, der Vagusnerv wird stimuliert. 30 Sekunden kaltes Wasser über Gesicht und Handgelenke können einen akuten Stresszustand durchbrechen.
Das ist keine Wellness-Empfehlung, sondern Neurobiologie: Der Körper kann nicht gleichzeitig in Panik sein und den Tauchreflex aktivieren.
Überkreuzbewegungen mögen albern aussehen, aber sie haben einen ernsten Hintergrund. Wenn die rechte Hand das linke Knie berührt und umgekehrt, müssen beide Gehirnhälften zusammenarbeiten.
Bei Stress ist oft eine Hemisphäre dominant – die Überkreuzbewegungen zwingen zur Integration. Auch die aus EMDR bekannten Augenbewegungen (8-10 mal langsam von links nach rechts schauen) nutzen diesen Mechanismus.
Das Gehirn kann nicht gleichzeitig bilateral integrieren und in Alarmbereitschaft bleiben.
Die Grenzen der Selbstregulation: Wann du mehr brauchst
Die dorsale Erstarrung ist tückisch. Man will sich bewegen, aber der Körper fühlt sich an wie in Blei gegossen. Man will fühlen, aber alles ist taub.
Hier direkt in die Entspannung zu wollen, ist wie von null auf hundert zu beschleunigen – es funktioniert nicht. Der Weg führt über sanfte Mobilisierung.
Das beginnt mit winzigen Bewegungen. Finger bewegen. Zehen wackeln. Die Schultern einen Millimeter anheben. Dem erstarrten System zu zeigen:
"Wir leben noch, wir können uns bewegen." Diese Mikrobewegungen mögen lächerlich klein erscheinen, aber für ein Nervensystem in dorsaler Erstarrung sind sie revolutionär.
Von dort aus werden die Bewegungen größer: Schultern kreisen, aufstehen, den Körper sanft schütteln. Das Ziel ist nicht Sport, sondern dem Körper zu helfen, aus der Starre in die Mobilisierung zu kommen – und von dort in die Regulation.
Sensorische Stimulation kann Wunder wirken. Ein Eiswürfel auf der Haut, der Geruch von Pfefferminzöl, der Geschmack einer Zitrone – diese intensiven Sinnesreize durchbrechen die Taubheit.
Sie rufen dem Nervensystem zu: "Du bist hier, du bist jetzt, du lebst." Es geht nicht um Schmerz, sondern um Intensität, die stark genug ist, die Dissoziation zu durchdringen.
Eine besonders sanfte, aber tiefgreifende Technik ist Summen und Tönen. Die Vibrationen im Brust- und Halsbereich stimulieren direkt den Vagusnerv.
Ein einfaches "Mmmmmh" oder "Ohhhhm" – die Vibration sollte im Brustkorb spürbar sein. Das ist keine esoterische Praxis, sondern pure Physiologie: Der Vagusnerv verläuft durch den Halsbereich, und Vibrationen aktivieren ihn.
Wenn nichts mehr geht: Der Weg aus der Erstarrung
Diese Techniken sind wertvoll. Sie können akute Zustände lindern und das Nervensystem unterstützen. Aber – und das ist wichtig zu verstehen – bei tiefem Entwicklungstrauma oder komplexer PTBS sind sie Symptommanagement, keine Heilung.
Warum reichen Selbsthilfe-Techniken oft nicht aus? Die Antwort liegt in der Art, wie unser Nervensystem lernt und heilt. Ein Kind entwickelt seine Fähigkeit zur Selbstregulation durch Co-Regulation – durch das Spiegeln und Beruhigtwerden durch die Bezugsperson.
Wenn die Mutter das weinende Baby beruhigt, leiht sie ihm buchstäblich ihr reguliertes Nervensystem. Mit der Zeit internalisiert das Kind diese Erfahrung und kann sich selbst beruhigen.
Bei Entwicklungstrauma fehlt genau diese Erfahrung. Das Nervensystem hat nie gelernt, wie sich Sicherheit anfühlt. Es kennt nur Alarmbereitschaft oder Abschaltung.
Atemübungen können die Symptome lindern, aber sie können nicht die fehlende Grunderfahrung von Co-Regulation ersetzen.
Die Forschung von Allan Schore zeigt: Traumaheilung braucht eine "regulierte andere Person".
In der therapeutischen Beziehung passiert das, was in der Kindheit gefehlt hat – das dysregulierte Nervensystem wird vom regulierten Nervensystem des Therapeuten "eingestimmt".
Unser Nervensystem lernt durch das Nervensystem eines anderen, wie Sicherheit geht. Das ist keine Therapie-Technik, die man aus einem Buch lernen kann.
Es ist ein Beziehungsprozess, bei dem zwei Nervensysteme miteinander in Resonanz gehen – wie zwei Instrumente, die sich aufeinander einstimmen.
Dazu kommt: Menschen mit Bindungstrauma haben oft blinde Flecken in der Selbstwahrnehmung. Sie spüren nicht, wenn sie dissoziieren. Sie merken nicht, dass sie in toxischen Mustern gefangen sind.
Sie halten Hypervigilanz - also das permanente scannen der Umwelt auf Gefahren für normal. Ein geschulter Therapeut erkennt diese Muster und kann sie spiegeln – etwas, was Selbsthilfe nicht leisten kann.
Besonders in toxischen Beziehungen wird die Grenze der Selbstregulation deutlich.
Wenn der Partner das Nervensystem ständig triggert, wenn Gaslighting die eigene Wahrnehmung untergräbt, wenn intermittierende Verstärkung eine Trauma-Bindung erzeugt – dann ist es, als würde man versuchen, ein Feuer zu löschen, während jemand ständig Benzin nachgießt.
Das Nervensystem braucht erst Sicherheit, bevor es heilen kann.
Professionelle Begleitung ist keine Schwäche oder ein Versagen der Willenskraft. Es ist die Anerkennung einer neurobiologischen Realität:
Ein Nervensystem, das in Beziehungen traumatisiert wurde, heilt am effektivsten in einer sicheren therapeutischen Beziehung.
Die Techniken zur Selbstregulation sind wichtige Werkzeuge für den Alltag – aber sie ersetzen nicht die transformative Kraft einer co-regulierenden Beziehung.
Wann professionelle Begleitung unverzichtbar wird
Es gibt klare Anzeichen, dass Selbstregulationstechniken allein nicht ausreichen. Wenn du dich in mehreren dieser Punkte wiedererkennst, ist professionelle Unterstützung kein Luxus, sondern Notwendigkeit:
Chronische Dysregulation trotz regelmäßiger Übung:
Du wendest die Techniken seit Monaten an, aber bleibst in extremen Zuständen gefangen. Dein Nervensystem findet nicht in die Balance.
Flashbacks und Dissoziation:
Du erlebst unkontrollierbare Erinnerungen, verlierst den Bezug zur Gegenwart oder fühlst dich häufig "neben dir stehend". Diese Zustände erfordern traumaspezifische Behandlung.
Toxische Beziehungsmuster:
Du gerätst immer wieder in destruktive Beziehungen oder bleibst in einer gefangen, obwohl du weißt, dass sie dir schadet. Hier braucht es mehr als Atemtechniken – es braucht Arbeit an den zugrundeliegenden Bindungsmustern.
Selbstverletzendes Verhalten:
Ob Substanzmissbrauch, Selbstverletzung oder extreme Risikobereitschaft – diese Bewältigungsstrategien zeigen, dass das Nervensystem verzweifelt nach Regulation sucht und professionelle Hilfe braucht.
Suizidale Gedanken:
Wenn der Schmerz so groß wird, dass der Tod wie eine Lösung erscheint, ist sofortige professionelle Hilfe unerlässlich. Das ist keine Schwäche – es ist ein medizinischer Notfall.
Ein unschlagbares Team: Selbstregulation UND geeignete therapeutische Begleitung
Die effektivste Heilung entsteht durch die Kombination von Selbstregulationstechniken und professioneller Begleitung.
Die Techniken geben dir Werkzeuge für den Alltag – Momente der Beruhigung, wenn das System überkocht. Die therapeutische Beziehung bietet den sicheren Rahmen für tiefgreifende Veränderung.
In einer spezialisierten Traumatherapie lernst du nicht nur Techniken. Du erfährst korrigierende Beziehungserfahrungen.
Dein Nervensystem lernt durch die Co-Regulation mit dem Therapeuten, was es allein nicht lernen kann: dass Nähe sicher sein kann, dass du gesehen wirst ohne Bewertung, dass deine Gefühle Raum haben dürfen.
Ansätze wie Somatic Experiencing, NARM (NeuroAffective Relational Model) oder traumasensitive Körperpsychotherapie arbeiten direkt mit dem Nervensystem. Sie kombinieren Gesprächstherapie mit Körperarbeit, weil Trauma nicht nur im Kopf, sondern im ganzen System sitzt.
Ein realistischer Weg: Integration statt Perfektion
Heilung bedeutet nicht, nie wieder getriggert zu werden. Es bedeutet, schneller zurückzufinden in die Regulation.
Es bedeutet, den eigenen Zustand zu erkennen und zu wissen, was hilft. Es bedeutet, sich Unterstützung zu holen, wenn man sie braucht, statt sich durchzukämpfen.
Die Polyvagaltheorie lehrt uns: Unser Nervensystem ist nicht unser Feind. Es versucht, uns zu schützen – manchmal mit veralteten Strategien, die heute mehr schaden als nutzen. Wenn wir verstehen, wie es funktioniert, können wir mit ihm arbeiten statt dagegen.
Selbstregulation ist eine lebenslange Praxis. Manche Tage wird es leicht sein, deinen ventralen Vagus zu aktivieren. An anderen Tagen wirst du in alten Mustern gefangen sein. Das ist normal. Das ist menschlich. Der Unterschied ist:
Du bist diesen Zuständen nicht mehr ausgeliefert. Du hast Werkzeuge. Du hast Wissen. Und wenn die eigenen Ressourcen nicht reichen, weißt du, dass es Hilfe gibt.
Klare Grenzen, Innere Ruhe.
Das Coaching-Programm.
Tiefer eintauchen
Hier findest du weiterführende Artikel zu angrenzenden Themen:
Trauma Bonding: Wenn loslassen unmöglich scheint – und wie es doch gelingt
Entwicklungstrauma: Die unsichtbare Epidemie unserer Zeit
*Literatur/Quellen:
*Porges, S. W. (2017). Die Polyvagal-Theorie: Neurophysiologische Grundlagen der Therapie. Junfermann Verlag.
*Dana, D. (2020). Die Polyvagal-Theorie in der Therapie: Den Rhythmus der Regulation nutzen. Probst Verlag.
*Porges, S. W. & Dana, D. (2021). Polyvagal-Übungen für Sicherheit und Verbundenheit. Probst Verlag.
*van der Kolk, B. (2015). Verkörperter Schrecken: Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper. Probst Verlag.
*Levine, P. A. (2011). Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Trauma verarbeitet. Kösel Verlag.
*Schore, A. N. (2007). Affektregulation und die Reorganisation des Selbst. Klett-Cotta.
*Rosenberg, S. (2019). Der Selbstheilungsnerv: So bringt der Vagusnerv Psyche und Körper ins Gleichgewicht. VAK Verlag.
*Walker, P. (2020). Complex PTSD: From Surviving to Thriving. Azure Coyote. [Englisch, deutsche Ausgabe in Vorbereitung]