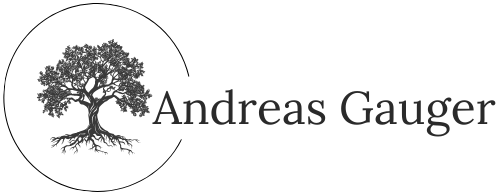Die narzisstische Persönlichkeitsstörung gehört zu den komplexesten Persönlichkeitsstörungen. Sie gilt als schwer behandelbar und führt zu erheblichen psychosozialen Beeinträchtigungen – sowohl für das soziale Umfeld als auch langfristig für die Betroffenen selbst.
Hinweis: Dieser Artikel ist ein Fachbeitrag im wissenschaftlichen Stil und richtet sich an fachlich Interessierte, die sich vertieft mit der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung befassen möchten. Wenn du selbst gerade von narzisstischen Dynamiken betroffen bist und konkrete Unterstützung suchst, findest du auf dieser Seite jede Menge andere praxisnahe Artikel, die dir Orientierung im Alltag geben.
Definition: Narzisstische Persönlichkeitsstörung
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist charakterisiert durch ein tiefgreifendes Muster von Grandiosität, einem übermäßigen Bedürfnis nach Bewunderung und ausgeprägter Kränkbarkeit.
Betroffene fordern Sonderbehandlung und Privilegien ohne entsprechende Gegenleistung. Sie überschätzen systematisch ihre Fähigkeiten und Leistungen bei gleichzeitiger Entwertung anderer.
Die Diagnose setzt eine erhebliche Funktionsbeeinträchtigung in wichtigen Lebensbereichen voraus – Beruf, Beziehungen, soziale Kontakte. Der Leidensdruck kann primär beim Umfeld liegen, während Betroffene ihre Problematik oft nicht wahrnehmen.
Bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung fehlt ein authentisches Selbst
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt sich typischerweise durch extreme Erziehungsmuster in der Kindheit – entweder chronische Entwertung oder unrealistische Überhöhung.
Bei chronischer Entwertung entsteht ein kompensatorisches Größenselbst als Abwehr gegen Kränkungen. Bei dauerhafter Überhöhung entwickelt sich Grandiosität ohne realistische Grundlage. In beiden Fällen lernt das Kind: "Normalität bedeutet Wertlosigkeit."
Die Geschlechterverteilung ist ausgeglichener als früher angenommen. Männer zeigen häufiger offene Grandiosität und Dominanzverhalten, Frauen eher verdeckte Formen mit Fokus auf Attraktivität oder soziale Perfektion. Diese Unterschiede reflektieren teilweise gesellschaftliche Geschlechterrollen.
Was bedeutet narzisstisch?
Der Begriff Narzissmus leitet sich vom griechischen Mythos des Narziss ab.
Henry Havelock Ellis (1898) verband als Erster die mythologische Figur mit pathologischer Selbstliebe. Sein Konzept des "Auto-Erotismus" beschrieb zunächst eine sexuelle Fixierung auf die eigene Person.
Paul Näcke (1899) erweiterte das Konzept und definierte Selbstbewunderung als Kernmerkmal. Damit löste sich die Betrachtung von der rein sexuellen Komponente.
Sigmund Freud und die Narzisstische Persönlichkeitsstörung
Sigmund Freud prägte das moderne Verständnis des Narzissmus durch "Zur Einführung des Narzissmus" (1914). Er unterschied zwischen normalem und pathologischem Narzissmus.
Der primäre Narzissmus – die kindliche Phase, in der das Kleinkind sich als Zentrum der Welt erlebt – ist entwicklungspsychologisch normal und notwendig. Diese Phase wird im gesunden Verlauf überwunden.
Wesentliche Weiterentwicklungen des Konzepts erfolgten durch:
- Otto Kernberg: Objektbeziehungstheorie und maligner Narzissmus
- Heinz Kohut: Selbstpsychologie und Narzissmus als Entwicklungsdefizit
- Stephan Doering: Moderne Diagnostik und Therapieansätze
Der Pschyrembel definiert die narzisstische Persönlichkeitsstörung heute als:

Narzisstische Persönlichkeitsstörung Definition
"Form der spezifischen Persönlichkeitsstörung, die durch einen überhöht wirkenden, aber eigentlich instabilen Selbstwert mit leichter Kränkbarkeit gekennzeichnet ist. Zusätzlich besteht ein hohes Anspruchsdenken mit ausbeuterischem Beziehungsstil. Die Behandlung erfolgt überwiegend psychotherapeutisch und wird durch die oft fehlende Krankheitseinsicht erschwert. Chronische Verläufe sind häufig."
Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung als Teil der Cluster-B-Störungen
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung gehört zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Diese Gruppe umfasst:
- Narzisstische Persönlichkeitsstörung
- Antisoziale Persönlichkeitsstörung
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Histrionische Persönlichkeitsstörung
Das DSM-5 charakterisiert Cluster B durch dramatisches, emotionales und unberechenbares Verhalten.
Gemeinsame Merkmale der Cluster-B-Störungen:
- Emotionale Dysregulation
- Impulsivität
- Instabile Beziehungsmuster
- Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung
- Identitätsstörungen
Diese Störungen zeigen erhebliche Überschneidungen in den Symptomen, was für ein dimensionales Modell spricht.
Diagnose und Klinik der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Der Begriff "Narzissmus" wird inflationär verwendet. Die Alltagssprache bezeichnet damit oft jedes egoistische Verhalten – eine Verwässerung des klinischen Konzepts.
Narzisstische Züge sind zunächst normal und notwendig. Sie ermöglichen Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeit. Besonders der primäre Narzissmus in der frühen Kindheit ist entwicklungspsychologisch essentiell.
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung unterscheidet sich fundamental von alltäglichem Egoismus. Für die Diagnose müssen spezifische Kriterien über mindestens zwei Jahre erfüllt sein und zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen führen.
Die diagnostischen Kriterien sind im DSM-5 und der ICD-10 präzise definiert. Beide Klassifikationssysteme stimmen bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung weitgehend überein.
Ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit (in Fantasie oder Verhalten), Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathie. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter, und das Muster zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:
- 1Hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit (z.B. übertreibt die eigenen Leistungen und Talente; erwartet, ohne entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden).
- 2Ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe.
- 3Glaubt von sich, "besonders" und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder nur mit diesen verkehren zu können.
- 4Verlangt nach übermäßiger Bewunderung.
- 5Legt ein Anspruchsdenken an den Tag (d.h. übertriebene Erwartungen an eine besonders bevorzugte Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen).
- 6Ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch (d.h. zieht Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen).
- 7Zeigt einen Mangel an Empathie: Ist nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren.
- 8Ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn/sie.
- 9Zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen
Diagnosekriterien der deutschen ICD-10-GM
Die ICD-10 kodiert die narzisstische Persönlichkeitsstörung unter F60.8 "Sonstige Persönlichkeitsstörungen" statt als eigenständige Kategorie.
Diese Einordnung stammt aus den 1990er-Jahren, als die Forschungslage noch nicht so weit entwickelt war (geringere Evidenzbasis).
Die kontroverse Diskussion dreht sich dabei vor allem um die Frage, wie verlässlich die Diagnose gestellt werden kann (diagnostische Validität). Kritiker weisen auf erhebliche Überlappungen mit anderen Persönlichkeitsstörungen hin – besonders mit der antisozialen und histrionischen Persönlichkeitsstörung.
Für die Diagnose müssen neben den allgemeinen Kriterien für Persönlichkeitsstörungen mindestens fünf der folgenden Merkmale vorliegen:
Merkmale der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemäß ICD-10
Die Diagnosekriterien von DSM-5 und ICD-10 sind bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung tatsächlich weitgehend identisch. Dies ist bemerkenswert, da die beiden Systeme bei anderen Störungen oft deutliche Unterschiede aufweisen.
Bitte keine Selbst- oder Fremddiagnosen
Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und dem besseren Verständnis von Persönlichkeitsstörungen. Sie ersetzen keine professionelle Diagnose. Eine fundierte Diagnose kann nur durch ausgebildete Fachkräfte wie Psychiater oder klinische Psychologen nach ausführlicher Untersuchung gestellt werden. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungsbilder mit vielen Überschneidungen. Viele Symptome können auch andere Ursachen haben – von Stress über Depression bis zu körperlichen Erkrankungen. Eine Fehleinschätzung kann mehr schaden als nutzen. Nutze das Wissen als Orientierungshilfe, um problematische Verhaltensmuster besser einzuordnen. Wenn du vermutest, dass jemand in deinem Umfeld betroffen sein könnte, betrachte dies als Arbeitshypothese – nicht als feststehende Tatsache. Bei ernsthaften Belastungen oder Gefährdungssituationen such dir professionelle Unterstützung. Das gilt sowohl für den Umgang mit möglicherweise betroffenen Personen als auch für deine eigene psychische Gesundheit.
Wie häufig ist die Narzisstische Persönlichkeitsstörung?
der Menschen in Deutschland leiden an einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) in Zahlen
Geschlechterverteilung bei der NPS (m/w)
Anteil an klinisch erfassten Patienten in D
Suizidrate Narzisstische Persönlichkeitsstörung
Zuverlässige Angaben zur Häufigkeit (Prävalenz) der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind schwer zu gewinnen. Mehrere Faktoren erschweren die Erfassung:
Fehlende Krankheitseinsicht: Die Störung wird von den Betroffenen als normal und gerechtfertigt (ich-synton) erlebt. Betroffene suchen selten freiwillig Hilfe.
Zufallsdiagnosen: Die Diagnose erfolgt meist sekundär bei Behandlung von Depression, Suchterkrankungen oder Beziehungskrisen.
Verfälschung: Viele Diagnosen entstehen im forensischen Kontext – also bei Straftätern oder in Gutachten – und das verfälscht die Statistik (Selektionsbias).
Die Häufigkeit (Prävalenz) wird meist mit etwa 1 % angegeben. Eine große amerikanische Studie (NESARC) fand jedoch Werte bis zu 6,2 %. Diese Unterschiede hängen mit den jeweils verwendeten Diagnosekriterien und Erhebungsmethoden zusammen.
Wahrscheinlich liegt die tatsächliche Häufigkeit bei etwa 1–2 % der Bevölkerung. Die Dunkelziffer ist hoch – viele Betroffene wirken nach außen zunächst unauffällig und werden erst in Krisen erkannt.
Geschlechterverteilung bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die frühere Annahme einer 75:25-Verteilung (Männer:Frauen) ist überholt. Mehrere Faktoren verzerren die Geschlechterstatistik:
Verzerrung (diagnostischer Bias): Die DSM-5- und ICD-10-Kriterien erfassen vor allem die eher männlich geprägten Ausprägungen – offene Grandiosität, Dominanzstreben und aggressives Durchsetzungsverhalten.
Geschlechtsspezifische Manifestation: Frauen zeigen häufiger verdeckten Narzissmus. Während Männer mit Status und Macht prahlen, nutzen Frauen eher Attraktivität, soziale Perfektion oder Opferinszenierungen als narzisstische Strategien.
Kultureller Wandel: Mit zunehmender Gleichstellung zeigen Frauen vermehrt auch traditionell "männliche" narzisstische Verhaltensweisen in Karriere und Öffentlichkeit.
Aktuelle Übersichtsanalysen (Metaanalysen) zeigen eine Verteilung von etwa 60:40 (Männer : Frauen) – deutlich ausgeglichener als früher angenommen. Die Unterschiede erklären sich vor allem durch die einseitige Art der Erfassung, nicht durch tatsächliche Abweichungen in der Häufigkeit.
Wie äußert sich eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Die Manifestation der narzisstischen Persönlichkeitsstörung variiert nach Schweregrad und Subtyp. Leichtere Ausprägungen zeigen sich oft nur in spezifischen Kontexten – etwa beruflich, während private Beziehungen funktionaler bleiben.
Die Hauptsubtypen unterscheiden sich fundamental:
Grandioser Narzissmus: Offene Selbstüberhöhung, aggressive Durchsetzung, sichtbare Grandiosität. Häufig in Führungspositionen.
Verdeckter Narzissmus: Versteckte Grandiosität bei äußerer Unsicherheit, Opferhaltung, passive Aggression. Schwerer zu erkennen.
In jüngeren Jahren zeigen viele Betroffene beruflichen Erfolg. Grandiosität und Charisma können kurzfristig Vorteile bringen. Mit zunehmendem Alter häufen sich jedoch narzisstische Krisen.
Typische Auslöser:
- Alterungsprozesse und körperlicher Abbau
- Berufliche Rückschläge oder Machtverlust
- Verlust wichtiger Bewunderungsquellen
Die Suizidrate liegt nach verschiedenen Studien zwischen 10 und 16 Prozent – und gehört damit zu den höchsten unter den Persönlichkeitsstörungen. Im Vergleich: Bei der Major Depression wird die Suizidrate mit rund 15 Prozent angegeben. Der Zusammenbruch der narzisstischen Abwehr kann zu schweren Depressionen und Suizidalität führen.
Das grandiose Selbstbild darf nicht wanken
Das grandiose Selbstbild dient als Abwehr gegen Depression und Suizidalität. Solange die Grandiosität aufrechterhalten wird, bleiben Selbstzweifel und Verzweiflung unterdrückt.
Der Zusammenbruch der narzisstischen Abwehr kann katastrophal sein.
Typische Auslöser:
- Unheilbare Krankheitsdiagnosen
- Öffentliche Demütigung
- Irreversibler Statusverlust
- Nicht mehr kompensierbare Alterungsprozesse
Wenn die Abwehr versagt, entsteht ein psychisches Vakuum. Das grandiose Selbst kollabiert, aber ein realistisches Selbstbild existiert nicht. Diese narzisstische Krise geht oft mit schwerer Depression einher.
Besonders gefährdet sind ältere Betroffene, bei denen sich Kränkungen durch körperlichen Abbau, Machtverlust und soziale Isolation kumulieren.
Der Suizid kann im Extremfall als letzter narzisstischer Versuch verstanden werden, die Kontrolle über das eigene Lebensnarrativ zu behalten.
Die 5 Kerneigenschaften der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist durch fünf Kerneigenschaften charakterisiert, die alle vorhanden sein müssen. Reinhard Haller systematisierte diese als die "5 E's":
- Egozentrismus
Unfähigkeit zur Perspektivübernahme. Eigene Ansichten werden als objektive Wahrheit erlebt. - Eigensucht
Zwanghaftes Kreisen um die eigene Person. Alle Interaktionen werden durch den Filter der narzisstischen Zufuhr bewertet. - Empathiemangel
Defizitäre emotionale Empathie bei erhaltener kognitiver Empathie. Gefühle anderer werden erkannt, aber nicht nachempfunden. - Empfindlichkeit
Extreme Kränkbarkeit bei Unfähigkeit zur konstruktiven Kritikverarbeitung. - Entwertung
Systematische Herabsetzung anderer zur Aufrechterhaltung der eigenen Grandiosität.
Damit eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden kann, müssen alle Kriterien gemeinsam erfüllt sein. Wenn eines fehlt, reicht es für die Diagnose nicht aus. Wie stark sich die Merkmale zeigen, kann je nach Subtyp und Lebenskontext unterschiedlich ausfallen.
Entwertung ist eine der unangenehmsten Eigenschaften von Narzissten
Entwertung ist ein zentrales Merkmal der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die Mechanismen variieren:
- Kompensatorische Entwertung: Menschen, die selbst dauerhaft entwertet wurden, geben dieses Muster oft weiter. Eine Weitergabe über Generationen hinweg wird in der Forschung immer wieder beschrieben.
- Entwertung als Leistungsersatz: Narzissten ohne eigene Erfolge stabilisieren ihr Selbstbild durch Herabsetzung anderer.
Für die Differentialdiagnose ist entscheidend: Alle fünf Kerneigenschaften müssen vorliegen. Entwertung allein reicht nicht aus. Wer andere kritisiert, aber eigene Fehler eingestehen kann, zeigt keine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Der Unterschied zeigt sich im Umgang mit eigenen Fehlern: Während nicht-narzisstische Personen Fehler zugeben können, werden diese bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung häufig geleugnet, auf andere geschoben oder umgedeutet.
Die mangelnde Fähigkeit, eigene Fehler einzuräumen, gilt als besonders kennzeichnend (pathognomonisch) für dieses Störungsbild.
1. Egozentrismus
Egozentrismus ist das bekannteste Merkmal der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Er unterscheidet sich fundamental von Egoismus.
Egoismus ist die bewusste Bevorzugung eigener Interessen. Der Egoist versteht andere Perspektiven, entscheidet sich aber dagegen.
Egozentrismus ist die Unfähigkeit zur Perspektivübernahme. Die eigene Wahrnehmung wird als objektive Realität erlebt.
Der Unterschied zeigt sich in der Sprache:
- Egoist: "Mir gefällt das nicht"
- Egozentriker: "Das ist hässlich"
Der erste erkennt Subjektivität an, der zweite nicht.
Bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung wird Egozentrismus pathologisch. Widerspruch wird nicht als andere Meinung, sondern als Realitätsverletzung erlebt. Diese starre Weltsicht führt zu massiven Spannungen in Beziehungen – besonders dann, wenn die betroffene Person eine Macht- oder Führungsposition innehat.
Die neurologische Basis liegt vermutlich in Defiziten der Theory of Mind – der Fähigkeit, mentale Zustände anderer zu repräsentieren. Bildgebende Verfahren zeigen reduzierte Aktivität im medialen präfrontalen Kortex bei Perspektivübernahme-Aufgaben.
2. Eigensucht
Eigensucht ist nicht Eigenliebe, sondern zwanghafte Selbstbezogenheit. Gesunde Selbstliebe ermöglicht Selbstkritik und Wachstum. Narzisstische Eigensucht ist ein rigides Kreisen um die eigene Person.
Die Selbstbezogenheit geht über Eitelkeit hinaus. Alle Informationen werden durch den Filter der narzisstischen Zufuhr verarbeitet: Alles, was das Selbstbild stärkt, wird übernommen. Alles, was es bedroht, wird abgewehrt oder verdrängt.
Typische Verhaltensweisen:
- Exzessive Selbstbetrachtung in reflektierenden Oberflächen
- Fokussierung auf die eigene Person in sozialen Situationen
- Interpretation neutraler Ereignisse als selbstbezogen
In schweren Fällen entwickelt sich selbstbezogene Beziehungsideen: Neutrale Ereignisse werden als auf die eigene Person bezogen interpretiert. Dies ähnelt paranoiden Symptomen, hat aber narzisstische Qualität – alles bezieht sich auf die eigene Grandiosität oder deren Bedrohung.
Die neurobiologische Grundlage zeigt sich in verstärkter Aktivierung selbstbezogener Hirnregionen (medialer präfrontaler Kortex) bei gleichzeitig reduzierter Aktivität in Arealen für Fremdwahrnehmung.
3. Empathielosigkeit
Die Empathiestörung bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist komplex. Es existieren zwei Formen der Empathie:
- Kognitive Empathie bezeichnet das intellektuelle Verstehen fremder Gefühlszustände. Diese ist bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung oft überdurchschnittlich ausgeprägt. Betroffene erkennen präzise emotionale Signale und nutzen dieses Wissen strategisch.
- Emotionale Empathie – also das tatsächliche Mitfühlen – ist hingegen deutlich eingeschränkt. Spiegelneurone, die bei Gesunden emotionale Resonanz erzeugen, zeigen reduzierte Aktivität. Das Leid anderer wird erkannt, aber nicht nachempfunden.
Diese Trennung von Verstehen und Mitfühlen (Dissoziation) macht Manipulation besonders wirksam. Narzissten erkennen die emotionalen Schwachstellen anderer sehr genau und nutzen dieses Wissen gezielt – als Information, nicht aus Mitgefühl.
Selbstmitleid zeigt ein paradoxes Muster. Während Empathie für andere fehlt, wird eigenes Leid dramatisiert. Bei grandiosem Narzissmus tritt Selbstmitleid erst in der narzisstischen Krise auf. Bei verdecktem Narzissmus ist es Kernmerkmal – die Opferrolle wird zur Identität.
Die Frage "Warum passiert das ausgerechnet mir?" bei Schicksalsschlägen offenbart die narzisstische Anspruchshaltung – selbst vom Leben wird Sonderbehandlung erwartet.
4. Empfindsamkeit
Empfindlichkeit ist ein Kernmerkmal der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das grandiose Selbstbild ist fragil und benötigt ständigen Schutz.
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung reagieren auf minimale Kränkungen mit maximaler Intensität. Diese Überempfindlichkeit kontrastiert mit ihrer mangelnden Rücksichtnahme auf andere.
Typische Kränkungsauslöser:
- Direkte Kritik, selbst konstruktives Feedback
- Ausbleibende Sonderbehandlung oder Privilegien
- Erfolge anderer, besonders im direkten Umfeld
Die Reaktionen fallen oft völlig überzogen aus und halten sehr lange an. Kränkungen werden über Jahre hinweg nachgetragen. Diese extreme Empfindlichkeit dient dazu, das fragile Gefühl von Größe und Besonderheit zu schützen.
Anspruch auf Sonderbehandlung besteht unabhängig vom realen Status. Die Kluft zwischen Selbstbild und Realität führt immer wieder zu Konflikten. Bleibt die erwartete Bevorzugung aus, folgen Kränkung und Entwertung des "Täters".
Trennungsdrohungen lösen massive Abwehrreaktionen aus:
- Love Bombing mit übertriebenen Versprechungen
- Manipulation durch Drohungen
- Narzisstische Wut mit möglicher Eskalation
Trennungen bergen erhöhte Gewaltrisiken. Die Bedrohung des grandiosen Selbst kann zu gefährlichen Reaktionen führen. Strategische Vorbereitung und professionelle Unterstützung sind essentiell.
5. Entwertung
Entwertung ist zentral für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Sie reicht von alltäglichem Sarkasmus bis zu systematischen Kampagnen zur Zerstörung des Selbstwerts anderer.
Schweregrade der Entwertung:
- Alltäglich: Herablassende Kommentare, Sarkasmus
- Systematisch: Gezielte Angriffe auf Selbstwert und Identität
- Maligne: Kombination mit antisozialen und sadistischen Zügen
Bei der dunklen Triade (Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie) wird Entwertung zum Machtinstrument. Mit Sadismus entsteht die dunkle Tetrade – eine besonders destruktive Konstellation.
Entstehungsmechanismen:
Viele Narzissten haben selbst über längere Zeit Entwertung erfahren. Dieses Muster kann sich über Generationen hinweg fortsetzen – oft, weil das Mitgefühl für die Betroffenen fehlt und das Gelernte unbewusst weitergegeben wird.
Narzissten ohne eigene Erfolge nutzen Entwertung kompensatorisch. Statt eigener Leistung stabilisieren sie ihr Selbstbild durch Herabsetzung anderer.
Diese Entwertungsmechanismen sind nicht bewusst gesteuert, sondern tief in der Persönlichkeitsstruktur verankert. Das Verständnis dieser Dynamik ist für die klinische Einordnung essentiell.
15 weitere Merkmale der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Neben den fünf Kerneigenschaften zeigt die narzisstische Persönlichkeitsstörung weitere charakteristische Merkmale. Die folgenden 15 Eigenschaften treten häufig, aber nicht zwingend auf:
1. Keine Entschuldigungen
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung entschuldigen sich selten authentisch. Fehler werden externalisiert – die Schuld liegt bei anderen oder den Umständen.
Typische Verantwortungsabwehr:
- Schuldzuweisung an andere
- Verweis auf äußere Umstände
- Umdeutung der Realität
Subtyp-spezifische Unterschiede:
Bei grandiosem Narzissmus sind Entschuldigungen ausgeschlossen. Fehlverhalten wird umgedeutet oder geleugnet.
Bei verdecktem Narzissmus werden Pseudo-Entschuldigungen strategisch eingesetzt. Scheinbare Selbstkritik ("Ich bin zu sensibel") dient der Manipulation und verschiebt subtil die Verantwortung.
Die fehlende Fähigkeit zu einer echten Entschuldigung hängt mit der zerbrechlichen Grandiosität zusammen. Ein aufrichtiges Eingeständnis von Schuld würde das narzisstische Selbstbild ins Wanken bringen.
2. Einseitiges Verständnis
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erwarten größtmögliches Verständnis für die eigenen Belange, zeigen aber kaum Bereitschaft, die Perspektive anderer einzunehmen.
Dieses Ungleichgewicht ist Teil der Störung. Eigene Bedürfnisse werden als objektiv wichtiger erlebt – nicht aus bewusster Entscheidung, sondern aus einer egozentrischen Weltsicht heraus.
Das fehlende Gleichgewicht in Geben und Nehmen zeigt sich in allen Beziehungen – privat wie beruflich. Unterstützung wird selbstverständlich eingefordert, aber selten zurückgegeben.
3. Anspruch auf Sonderbehandlung
Die Erwartung von Privilegien ist charakteristisch für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Diese Anspruchshaltung besteht unabhängig von tatsächlichen Leistungen.
Typische Erwartungen:
- Bevorzugung ohne Gegenleistung
- Ausnahmen von Regeln
- Sofortige Bedürfnisbefriedigung
- Priorität vor anderen
Bleibt die Sonderbehandlung aus, reagieren Betroffene oft mit Kränkung, Wut, Entwertung oder sogar Racheimpulsen. Diese Reaktion dient dazu, das bedrohte Selbstbild zu stabilisieren.
Die Anspruchshaltung zeigt sich in allen Lebensbereichen. Normale soziale Regeln werden als nicht für sie geltend erlebt. Diese Erwartung auf besondere Behandlung wird als selbstverständlich erlebt (ich-synton) – für die Betroffenen wirkt sie völlig gerechtfertigt.
4. Delegation unangenehmer Aufgaben
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung delegieren routinemäßig alle als "niedrig" empfundenen Tätigkeiten. Dies überschreitet normale Arbeitsteilung und reflektiert die grandiose Selbstwahrnehmung.
Typische Rationalisierungen:
- Eigene Zeit sei zu wertvoll
- Fokus auf "Wesentliches" nötig
- Einzigartigkeit der eigenen Fähigkeiten
Die Delegation erfolgt ohne Gegenseitigkeit (Reziprozität). Unterstützung bei den Aufgaben anderer wird verweigert – und diese Einseitigkeit erscheint den Betroffenen völlig selbstverständlich.
Die Grenze zwischen normaler Arbeitsteilung und narzisstischer Ausbeutung liegt genau hier: in der fehlenden Gegenseitigkeit und in der Abwertung der Aufgaben anderer. Was andere tun, wird als minderwertig angesehen.
5. Explosive Wutausbrüche
Die narzisstische Wut ist unverhältnismäßig zur auslösenden Situation. Sie entsteht aus der Diskrepanz zwischen grandioser Erwartung und Realität.
Typische Auslöser:
- Widerspruch oder Kritik
- Nicht-Beachtung
- Verweigerung von Sonderbehandlung
- Erfolge anderer
Die Wut dient der Wiederherstellung der narzisstischen Homöostase. Die bedrohte Grandiosität wird durch Aggression verteidigt.
Subtyp-spezifische Ausprägungen:
Grandioser Narzissmus: Offene, explosive Wut mit verbalen oder physischen Ausbrüchen.
Verdeckter Narzissmus: Passive Aggression, emotionaler Rückzug als Bestrafung.
Maligner Narzissmus: Eine kalte, berechnende Form von Wut, die auf völlige Zerstörung abzielt. In Kombination mit antisozialen Zügen können daraus sogar langfristig geplante Racheakte entstehen. Diese Variante gilt als besonders riskant.
Die Intensität und Dauerhaftigkeit (Persistenz) der narzisstischen Wut unterscheidet sie von normaler Verärgerung. Sie kann über Monate oder sogar Jahre anhalten.
6. Nachtragend bis ins Unermessliche
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind oft extrem nachtragend. Kränkungen werden nicht verarbeitet, sondern über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte bewahrt.
Charakteristische Merkmale:
Zeitliche Dauerhaftigkeit (Persistenz): Kränkungen verjähren nicht. Die emotionale Intensität bleibt über sehr lange Zeiträume bestehen.
Unverhältnismäßigkeit: Schon kleine Vorfälle können dauerhaften Groll auslösen.
Fehlende Versöhnungsbereitschaft: Entschuldigungen werden nicht akzeptiert, sondern die Kränkungen gesammelt und später als Begründung für eigene Aggressionen genutzt.
Ein solch anhaltender Groll unterscheidet sich deutlich von normalem Nachtragendsein. Er wird von den Betroffenen als völlig stimmig und gerechtfertigt erlebt (ich-synton), bewusst gepflegt und auch strategisch genutzt. Paradoxerweise stabilisiert dieses „Sammeln von Kränkungen“ das narzisstische Selbstgefühl.
7. Ständige Manipulation
Manipulation ist bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung ein Kernverhalten. Sie erfolgt meist intuitiv als internalisiertes Muster, nicht als bewusste Strategie.
Haupttechniken:
Love Bombing: Überwältigende Zuneigung in der Anfangsphase zur schnellen Bindungserzeugung.
Triangulation: Einbeziehung Dritter zur Erzeugung von Eifersucht oder Konkurrenz.
Gaslighting: Systematische Infragestellung der Realitätswahrnehmung des Gegenübers.
Variable Verstärkung: Unvorhersehbarer Wechsel zwischen Zuneigung und Ablehnung erzeugt Abhängigkeit.
Moving Goalposts: Ständig wechselnde Anforderungen verhindern Erfolgserlebnisse.
Die Manipulation dient der Sicherung narzisstischer Zufuhr und der Kontrolle. Schwächen anderer werden registriert und später instrumentalisiert.
Diese Verhaltensweisen sind tief internalisiert und laufen automatisch ab. Die Manipulation ist ich-synton – sie wird nicht als manipulativ erlebt, sondern als normale Interaktion.
8. Kaum echte Freundschaften
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben selten dauerhafte Freundschaften. Ihre Beziehungen folgen einem vorhersehbaren Zyklus: Idealisierung, Ausbeutung, Entwertung, Abbruch.
Verletzung der sozialen Reziprozität:
Das Prinzip der Gegenseitigkeit wird systematisch gebrochen:
- Unterstützung wird erwartet, aber nicht gewährt
- Verfügbarkeit wird gefordert, aber nicht geboten
- Kontakte werden als Ressourcen genutzt
Typischer Beziehungsverlauf:
Phase 1: Intensive Kontaktaufnahme bei erkennbarem Nutzen
Phase 2: Einseitige Instrumentalisierung als Zuhörer, Problemlöser oder Bewunderungsquelle
Phase 3: Abwertung und Rückzug bei Grenzsetzung oder eigenen Bedürfnissen des anderen
Längerfristige Beziehungen halten meist nur zu abhängigen Persönlichkeiten, die Ausbeutung hinnehmen, oder zu anderen Narzissten in zweckgebundenen Bündnissen. Da es an emotionaler Tiefe und Gegenseitigkeit fehlt, entstehen kaum echte Freundschaften.
9. Unrealistische Selbstüberschätzung
Die systematische Selbstüberschätzung bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung manifestiert sich in allen Lebensbereichen. Fähigkeiten werden überschätzt, Risiken unterschätzt, Warnzeichen ignoriert.
Frühe Verstärkung:
Anfängliche Erfolge durch Charisma und Risikobereitschaft können die Grandiosität verstärken. Diese zufälligen Erfolge werden als Beweis der eigenen Außergewöhnlichkeit interpretiert.
Langfristige Konsequenzen:
Mit steigender Komplexität der Anforderungen wird die Selbstüberschätzung dysfunktional:
- Gescheiterte Projekte durch Ignorieren von Expertise
- Finanzielle Verluste durch Fehleinschätzungen
- Berufliche Stagnation durch Überforderung
Die fehlende Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung gehört fest zur narzisstischen Struktur. Misserfolge werden konsequent auf andere oder auf die Umstände geschoben – niemals auf die eigene Überschätzung.
Diese verzerrte Selbstwahrnehmung wird als völlig stimmig und gerechtfertigt erlebt (ich-synton) und ist ein zentraler Bestandteil der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Eine Korrektur würde das grandiose Selbstbild massiv bedrohen.
10. Kein Problem mit Konflikten
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung vermeiden Konflikte nicht. Konfrontationen werden zur Demonstration von Dominanz genutzt.
Eskalationsmuster:
Alltägliche Situationen werden zu Machtkämpfen umgedeutet. Normale Interaktionen werden als Kränkung erlebt und lösen unverhältnismäßige Reaktionen aus.
Funktion der Konfliktbereitschaft:
- Wiederherstellung gefühlter Hierarchie
- Abwehr narzisstischer Kränkungen
- Demonstration von Macht
- Erzwingung von Sonderbehandlung
Die niedrige Konfliktschwelle resultiert aus der Kombination von extremer Kränkbarkeit und mangelnder Impulskontrolle. Jede wahrgenommene Missachtung triggert aggressive Verteidigung.
Der Unterschied zu normaler Durchsetzungsfähigkeit liegt in der Unverhältnismäßigkeit und der verzerrten Wahrnehmung. Neutrale Situationen werden als persönliche Angriffe interpretiert und entsprechend beantwortet.
11. Erwartung von Bewunderung
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erwarten Anerkennung für alltägliche Verrichtungen. Diese verzerrte Leistungswahrnehmung ist charakteristisch.
Mechanismus der Verzerrung:
Normale Handlungen werden durch den Filter der Grandiosität als außergewöhnliche Leistungen erlebt. Routineaufgaben werden zu bedeutsamen Beiträgen umgedeutet.
Reaktion auf ausbleibende Bewunderung:
- Narzisstische Kränkung
- Entwertung der Umgebung
- Rückzug der Kooperation
Die Kluft zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist groß. Was objektiv nur normale Pflichterfüllung ist, erscheint den Betroffenen subjektiv wie eine besondere Leistung.
Diese Anspruchshaltung wird als selbstverständlich erlebt (ich-synton). Für die Betroffenen wirken ihre Erwartungen völlig gerechtfertigt. Bleibt Anerkennung aus, wird das nicht als realistische Einschätzung verstanden, sondern als Ungerechtigkeit oder Neid.
12. Starke Handlungsorientierung
Der grandiose Subtyp zeigt ausgeprägte Handlungsorientierung. Reflexion wird als Schwäche interpretiert, Aktion als Stärke.
Charakteristika:
- Schnelle, impulsive Entscheidungen
- Ignorieren von Warnsignalen
- Unterschätzung von Komplexität
"Love Bombing" und Beziehungsbeschleunigung:
Ein charakteristisches Muster ist das überstürzte Vorantreiben von Bindungen. Innerhalb weniger Wochen werden weitreichende Verpflichtungen eingegangen – Zusammenziehen, gemeinsame Finanzen, Heirat.
Diese Beschleunigung dient mehreren Zwecken:
- Sicherung narzisstischer Zufuhr
- Schaffung von Abhängigkeiten
- Vermeidung der Entdeckung problematischer Persönlichkeitsaspekte
Die mangelnde Bereitschaft zur Reflexion zeigt sich in allen Lebensbereichen. Folgen werden oft nicht bedacht, und Fachwissen wird als unnötig abgetan. Diese Impulsivität kann anfangs wie Entschlossenheit wirken, führt auf Dauer jedoch zu erheblichen Problemen.
13. Ständiger Wettbewerb – sie müssen die Besten sein
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erleben soziale Interaktionen als Nullsummenspiel: Es gibt nur Gewinner oder Verlierer – Gleichwertigkeit existiert für sie nicht.
Diese Schwarz-Weiß-Sichtweise führt dazu, dass sie sich in allen Lebensbereichen ständig vergleichen:
- Beruflicher Status und Einkommen
- Physische Attraktivität
- Soziale Anerkennung
- Familiäre "Erfolge"
Geschlechtsspezifische Tendenzen:
Männer messen sich dabei häufiger über beruflichen Status und finanzielle Macht, Frauen eher über äußere Attraktivität und soziale Perfektion. Diese Muster sind kulturell geprägt – nicht biologisch festgelegt.
Konsequenzen:
Der ständige Vergleich erzeugt dauerhaften Stress und verhindert echte, vertrauensvolle Beziehungen. Jede Interaktion wird als Wettkampf erlebt. Diese fehlende Fähigkeit zu echter Zusammenarbeit führt auf Dauer oft in soziale Isolation.
Die ständige Konkurrenz-Haltung wird von den Betroffenen als selbstverständlich erlebt (ich-synton). Zusammenarbeit gilt ihnen als Schwäche, während Konkurrenz als natürlicher Zustand erscheint.
14. Jede Situation wird zum Wettkampf
Bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung existieren keine harmlosen Aktivitäten. Jede Situation wird zur Überlegenheitsdemonstration.
Pathologische Unfähigkeit zu verlieren:
Niederlagen werden als existenzielle Bedrohung der Grandiosität erlebt. Selbst bedeutungslose Misserfolge lösen narzisstische Krisen aus.
Konkurrenz mit eigenen Kindern:
Besonders pathologisch ist der Wettbewerb mit den eigenen Kindern. Narzisstische Eltern konkurrieren um Aufmerksamkeit, Erfolg und Attraktivität. Diese Dynamik ist entwicklungspsychologisch hochgradig schädlich.
Kinder benötigen sichere Bindungen und bedingungslose Akzeptanz. Stattdessen werden sie zu Rivalen in einem destruktiven Konkurrenzkampf, der ihre Entwicklung massiv beeinträchtigen kann.
Langzeitfolgen:
Kinder narzisstischer Eltern zeigen erhöhte Raten von:
- Angststörungen
- Depression
- Eigenen Persönlichkeitsstörungen
- Bindungsstörungen
Die Weitergabe narzisstischer Muster über Generationen hinweg wird in der Forschung immer wieder beschrieben. Ein solcher zerstörerischer Wettbewerb erschwert die gesunde Entwicklung von Eigenständigkeit und stabilem Selbstwert.
15. Keine Rücksicht auf eigene Belastungsgrenzen
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zeigen selbstschädigende Leistungsmuster. Die Grandiosität fordert ständige Erfolgsbeweise – körperliche Grenzen werden geleugnet.
Typische Selbstüberforderung:
- Arbeiten trotz Krankheit
- Verzicht auf Erholung
- Substanzmissbrauch zur Leistungssteigerung
- Ignorieren medizinischer Warnsignale
Gesundheitliche Konsequenzen:
Studien zeigen erhöhte Prävalenz von:
- Kardiovaskulären Erkrankungen
- Burnout-Syndrom
- Substanzabhängigkeit
- Chronischen Schmerzsyndromen
Die Sterblichkeit (Mortalität) ist deutlich erhöht. Die Kombination aus Selbstüberforderung, Substanzmissbrauch und dem Ignorieren medizinischer Warnsignale kann zu vorzeitigen Todesfällen führen.
Paradoxe Reaktion auf Zusammenbruch:
Selbst schwere gesundheitliche Krisen werden oft geleugnet oder umgedeutet. Die Anerkennung körperlicher Grenzen würde die Grandiosität bedrohen.
Diese Selbstschädigung ist keine bewusste Entscheidung, sondern Ausdruck der fehlenden Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Die narzisstische Abwehr hält Betroffene davon ab, ihre eigene Verletzlichkeit (Vulnerabilität) wahrzunehmen.
Verschiedene Subtypen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeigt verschiedene Erscheinungsformen. Die Klassifikation erfolgt nach klinischen Merkmalen und Ausprägungsmustern.
Die drei Hauptsubtypen:
- Grandioser Narzissmus
Offene Selbstüberhöhung mit dominantem Auftreten. Die klassische Form mit sichtbarer Grandiosität. - Maligner Narzissmus
Kombination aus narzisstischen, antisozialen und aggressiven Zügen. Erhöhtes Gefährdungspotenzial durch fehlende Impulskontrolle und sadistische Tendenzen. - Vulnerabler Narzissmus
Verdeckte Form mit äußerer Unsicherheit bei innerer Grandiosität. Schwer zu diagnostizieren durch die defensive Fassade.
Diese Subtypen sind keine starren Kategorien. Mischformen kommen häufig vor, und die Übergänge sind fließend. Die Einteilung dient vor allem der klinischen Orientierung, nicht einer eindeutigen Zuordnung.
Die ICD-11 berücksichtigt diese Vielfalt (Heterogenität), indem sie Persönlichkeitsstörungen nach Schweregrad und Merkmalen beschreibt (dimensionale Erfassung) – und nicht mehr nur in starre Diagnose-Schubladen (kategoriale Diagnosen). Das entspricht der klinischen Realität besser als eine strikte Subtypeneinteilung.
Die 3 Hauptformen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Russ et al. (2008) beschrieben drei zentrale Subtypen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die sich in Selbstdarstellung, Empathiefähigkeit und Impulskontrolle unterscheiden.
Diese Einteilung basiert auf statistischen Gruppierungen (Clusteranalysen) klinischer Stichproben und zeigt klar unterscheidbare Merkmalsmuster. Die Subtypen unterscheiden sich deutlich in ihrer Symptomatik und ihrer Prognose.
1. Exhibitionistischer Narzissmus – der glänzende Performer
Der grandiose Narzissmus gilt als sozial erfolgreichste Variante. Betroffene sind oft hochfunktional und erreichen Führungspositionen.
Charakteristika:
- Offene Selbstdarstellung und Dominanz
- Hohe soziale Kompetenz bei emotionaler Oberflächlichkeit
- Charismatisches Auftreten
- Überrepräsentation in Machtpositionen
Paradox des Erfolgs:
Ihr Charisma und Selbstvertrauen werden in kompetitiven Umfeldern belohnt. Sie erreichen häufig CEO-, Chefarzt- oder Professorenpositionen. Die gesellschaftliche Verstärkung stabilisiert die Störung.
Organisationale Kosten:
In Führungspositionen zeigen sich dysfunktionale Entscheidungsmuster:
- Prestigeprojekte ohne Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Ignorieren von Expertise
- Kurzfristige Selbstinszenierung über Nachhaltigkeit
Die Kränkbarkeit erzeugt eine Kultur des Schweigens. Kritik wird sanktioniert, Fehler werden nicht korrigiert. Diese Dynamik macht narzisstische Führung zum erheblichen Organisationsrisiko.
Therapieresistenz:
Diese Gruppe sucht selten Hilfe – aus ihrer Sicht funktioniert alles optimal. Die gesellschaftliche Verstärkung und fehlende Krankheitseinsicht verhindern eine Behandlungsmotivation.
Abgrenzung zur Psychopathie:
Während narzisstische Führungskräfte durch Selbstüberschätzung schaden, agieren Psychopathen kalkuliert destruktiv. Narzisstisches Versagen resultiert aus Grandiosität, psychopathisches aus Gewissenlosigkeit.
2. Grandios-maligner Narzissmus – die gefährlichste Form
Der grandios-maligne Narzissmus kombiniert narzisstische Grandiosität mit paranoiden und antisozialen Zügen. Otto Kernberg prägte diesen Begriff für die gefährlichste Variante.
Die toxische Triade:
- Narzisstisch: Größenwahn und Anspruchsdenken
- Paranoid: Misstrauen, Verfolgungsideen
- Antisozial: Gewissenlosigkeit, Regelverachtung
Klinisches Bild:
Die Kombination erzeugt ein hochgefährliches Profil:
- Sadistische Tendenzen
- Extreme Rachsucht
- Paranoide Feindbilder
- Völlige Empathielosigkeit
- Erhöhte Gewaltbereitschaft
Forensische Relevanz:
Überrepräsentation bei:
- Gewaltverbrechern
- Wirtschaftskriminellen
- Sektenführern
- Extremisten
Präventive Aggression:
Die paranoide Komponente führt zu vorbeugenden Angriffen gegen vermeintliche Bedrohungen. Reale oder imaginierte Feinde werden vernichtet, bevor sie "gefährlich" werden können.
Eskalationsdynamik:
Anfangs können beeindruckende Erfolge erzielt werden durch Skrupellosigkeit und absolutes Selbstvertrauen. Die gleichen Eigenschaften führen jedoch später auch zur Selbstzerstörung:
- Eliminierung kompetenter Berater
- Realitätsverlust durch fehlende Korrektur
- Eskalation bis zur Selbstvernichtung
Die Behandlungsaussichten gelten in diesen Fällen als sehr schlecht (infaust). Die Kombination aus übersteigerter Selbstwahrnehmung, Misstrauen und Gewissenlosigkeit macht therapeutische Interventionen nahezu unmöglich.
Vulnerabel-fragiler Narzissmus – die verdeckte Variante
Der verdeckte Narzissmus schwankt zwischen Größenfantasien und Minderwertigkeitsgefühlen. Das Gefühl von Grandiosität ist dabei hinter einer Fassade scheinbarer Bescheidenheit verborgen.
Charakteristisches Erscheinungsbild:
- Äußerlich bescheiden, selbstkritisch, zurückhaltend
- Innerlich überzeugt von eigener Besonderheit
- Chronische Opferhaltung
- Passive Aggression statt offener Konfrontation
Die verborgene Grandiosität:
Trotz äußerer Unsicherheit besteht die feste Überzeugung, ein „verkanntes Genie“ zu sein. Der Widerspruch zwischen diesem Selbstbild und der erlebten Realität führt zu dauerhafter Frustration.
Abgrenzung zur Borderline-Störung:
Beide zeigen emotionale Instabilität, aber unterschiedliche Motivation:
- Borderline: Angst vor Verlassenwerden, Identitätsdiffusion
- Verdeckter Narzissmus: Gekränkte Grandiosität, verletzte Ansprüche
Empathie-Paradox:
Verdeckte Narzissten zeigen mehr emotionale Empathie als andere Subtypen – doch diese bleibt vor allem ein Mittel zum Zweck (instrumentell). Mitgefühl wird gezielt eingesetzt, um Einfluss zu nehmen, und bricht sofort ab, sobald sie sich selbst gekränkt fühlen.
Dekompensation:
Bei Zusammenbruch der Abwehr folgen:
- Unkontrollierte Wutausbrüche
- Suizidale Krisen
- Dissoziation
- Verlängerter Rückzug
Die emotionale Instabilität macht diesen Subtyp behandlungsbedürftiger, aber auch behandlungsfähiger – das Leiden wird bewusster erlebt als beim grandiosen Typ.
Hohe Überschneidungen mit anderen Störungen
Die verdeckte Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geht oft mit anderen psychischen Störungen einher. Häufig treten zusätzlich auf:
- Dependente Persönlichkeitsstörung
- Generalisierte Angststörung
- Major Depression
- Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
Viele dieser Begleiterkrankungen sind so stark ausgeprägt, dass sie als eigenständige Diagnosen gestellt werden.
Weitere Gesichter der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Neben der klassischen Dreiteilung gibt es weitere Typologien. Die Unterscheidung zwischen „männlichem“ und „weiblichem“ Narzissmus beruht auf beobachteten Tendenzen, nicht auf festen Zuordnungen.
Diese Begriffe beschreiben Verhaltensmuster – keine biologischen Festlegungen.
Hallers erweiterte Typologie
Der österreichische Psychiater Reinhard Haller entwickelte eine differenzierte Klassifikation mit zwölf Subtypen:
- Der beleidigte Narzisst: Chronisch gekränkt, sammelt Ungerechtigkeiten
- Der demütige Narzisst: Grandiosität durch gespielte Bescheidenheit
- Der sozial angepasste Narzisst: Funktional integriert, verdeckte Grandiosität
- Der konstruktive Narzisst: Nutzt narzisstische Energie produktiv
- Der fanatische Narzisst: Verschmilzt mit Ideologie oder Mission
- Der Wüterich: Explosiv, nutzt Aggression zur Dominanz
- Der maligne Narzisst: Kombination mit antisozialen Zügen
- Der parasitäre Narzisst: Lebt von anderen, ohne Gegenleistung
- Der amouröse Narzisst: Definiert sich über sexuelle Eroberungen
- Der kompensatorische Narzisst: Grandiosität als Abwehr gegen Trauma
- Der perfektionistische Narzisst: Unerreichbare Standards für sich und andere
- Narziss der Große: Klassische grandiose Form
Diese Einteilung ist für die klinische Praxis hilfreich, weil sie die Vielfalt (Heterogenität) der Störung abbildet. In der Realität zeigen Betroffene jedoch häufig Mischformen oder wechseln je nach Lebensphase und Kontext zwischen verschiedenen Subtypen.
Begleiterkrankungen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) sind bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eher die Regel als die Ausnahme. Oft führen sie überhaupt erst zur Diagnose, da die Persönlichkeitsstörung selbst nur selten der direkte Anlass für eine Behandlung ist.
Häufige Komorbiditäten:
- Depression nach narzisstischen Kränkungen
- Substanzstörungen zur Leistungssteigerung oder Affektregulation
- Angststörungen bei Statusbedrohung
- Burnout durch Selbstüberforderung
Typischer Diagnoseweg:
Betroffene suchen Hilfe für die Begleiterkrankung, nicht für ihre Persönlichkeit. Die narzisstische Störung wird oft erst im Therapieverlauf erkannt, wenn grandiose oder entwertende Muster sichtbar werden.
Ich-Syntonie als Behandlungshindernis:
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erleben ihr Verhalten in der Regel als normal und gerechtfertigt (ich-synton). Schwierigkeiten werden auf andere oder die Umstände geschoben.
So möchte ein depressiver Narzisst meist nur die Depression behandeln lassen – nicht den zugrunde liegenden Narzissmus. Ziel ist dabei die Wiederherstellung der bisherigen Funktionsfähigkeit, nicht eine echte Persönlichkeitsveränderung. Diese fehlende Änderungsmotivation macht die Behandlung besonders schwierig.
Warum es so schwer ist, verlässliche Zahlen zu finden
Die Erfassung von Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist methodisch schwierig. Weil den Betroffenen oft das Krankheitsbewusstsein fehlt, werden viele Fälle nicht erfasst.
Die NESARC-Studie mit über 34.000 Teilnehmenden liefert hier besonders aussagekräftige Daten (epidemiologisch). Als Bevölkerungsstudie umgeht sie das Problem, dass viele Diagnosen sonst nur in klinischen oder forensischen Kontexten gestellt werden (klinische Selektion).
Komorbiditätsraten:
- Substanzstörungen: 40-60%
- Affektive Störungen: 40-50%
- Angststörungen: 40-50%
- Andere Persönlichkeitsstörungen: 40-60%
Eine „reine“ narzisstische Persönlichkeitsstörung – also ohne weitere Begleiterkrankungen – ist eher die Ausnahme. In den meisten Fällen treten mehrere zusätzliche Störungen (Komorbiditäten) gleichzeitig auf.
Klinische Implikationen:
Die häufigen Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) machen die Behandlung besonders komplex. Die narzisstische Persönlichkeitsstruktur erschwert zusätzlich den Umgang mit den einzelnen Störungen:
Therapien bei Substanzmissbrauch scheitern oft an fehlender Krankheitseinsicht
Die Behandlung von Depressionen wird durch narzisstische Abwehrmechanismen blockiert
Angststörungen stehen im Widerspruch zum grandiosen Selbstbild
Eine wirksame Therapie muss deshalb immer auf beiden Ebenen ansetzen – auf den akuten Symptomen und auf der tieferliegenden Persönlichkeitsstruktur. Das macht die Behandlung langwieriger und verringert die Erfolgsaussichten.
Lebenszeitprävalenz von Begleiterkrankungen
Die folgenden Daten stammen aus der oben erwähnten NESARC-Wave-2-Studie. Sie geben an, wie häufig zusätzliche psychische Störungen im Laufe des Lebens (Lebenszeitprävalenz) bei Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung auftreten.
Die Werte lassen sich in etwa auch auf westliche Industrienationen übertragen – Unterschiede in der Kultur können die genauen Raten jedoch beeinflussen.
Begleiterkrankungen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die folgende Tabelle zeigt die wechselseitige Beziehung (bidirektional) zwischen narzisstischer Persönlichkeitsstörung und anderen psychischen Störungen.
Lesehilfe:
Mittlere Spalte: Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung (NPS) die jeweilige Störung entwickeln
Rechte Spalte: Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit der jeweiligen Störung zusätzlich eine NPS haben
Die Übersicht macht deutlich: Eine NPS erhöht das Risiko für weitere Störungen – und umgekehrt treten bestimmte Erkrankungen besonders häufig zusammen mit einer NPS auf. Grundlage sind die Daten der NESARC-Wave-2-Studie.
Begleiterkrankung | Lebenszeitprävalenz von anderen psychiatrischen Störungen bei NPS | Lebenszeitprävalenz von NPS bei anderen psychiatrischen Störungen |
|---|---|---|
Suchterkrankungen | 64,2 % | 8,8 % |
Substanzmissbrauch | 35,7 % | 8,4 % |
Alkoholabhängigkeit | 30,6 % | 12,4 % |
Drogenabhängigkeit | 12,0 % | 22,0 % |
Nikotinabhängigkeit | 35,9 % | 9,6 % |
Affektive Störungen | 49,5 % | 11,9 % |
Major-Depression | 20,6 % | 7,7 % |
Bipolar-I-Störung | 20,1 % | 23,8 % |
Angststörungen | 54,7 % | 11,5 % |
Panikstörung (ohne AP) | 11,3 % | 11,9 % |
Sozialphobie | 15,5 % | 13,7 % |
Spezifische Phobie | 27,4 % | 11,2 % |
Generalisierte Angststörung | 19,8 % | 16,0 % |
PTBS | 25,7 % | 16,8 % |
Persönlichkeitsstörungen | 62,9 % | 20,2 % |
Cluster A | 38,3 % | 26,3 % |
Paranoide PS | 15,2 % | 21,8 % |
Schizoide PS | 8,5 % | 17,1 |
Schizotype PS | 27,5 % | 43,2 % |
Cluster B | 44,9 % | 28,2 % |
Antisoziale PS | 11,8 % | 18,9 % |
Borderline PS | 37,0 % | 38,9 % |
Histrionische PS | 9,4 % | 32,4 % |
Cluster C | 24,3 % | 15,9 % |
Vermeidende PS | 6,9 % | 18,4 % |
Abhängige PS | 1,7 % | 25,0 % |
Zwanghafte PS | 21,3 % | 16,3 % |
(*5 vgl. Stinson et al. 2008)
Ursachen: Wie entsteht eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht durch ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Eine einzelne Ursache (monokausale Erklärung) gibt es nicht.
Das biopsychosoziale Modell beschreibt drei Einflussbereiche:
- Biologische Faktoren: genetische Anfälligkeit (Vulnerabilität), Besonderheiten im Gehirn
- Psychologische Faktoren: frühe Bindungsstörungen, traumatische Erfahrungen
- Soziale Faktoren: Erziehungsstil, kulturelle Einflüsse
Diese Faktoren wirken nicht getrennt, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Eine genetische Veranlagung allein führt nicht zur Störung – erst belastende Umwelteinflüsse können die Entwicklung auslösen. Umgekehrt entwickeln nicht alle Kinder mit traumatischen Erfahrungen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt (Gen-Umwelt-Interaktion) ist komplex: Genetische Anfälligkeit verstärkt die Empfindlichkeit für ungünstige Einflüsse. Schutzfaktoren können dagegen verhindern, dass sich trotz Risiken eine Störung entwickelt.
Warum eine klare Abgrenzung schwierig ist
Die Entstehung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung beruht auf einem komplexen Zusammenspiel zwischen genetischen Anlagen und Umweltfaktoren. Wie stark die einzelnen Faktoren jeweils wirken, wird in Studien sehr unterschiedlich bewertet.
Schätzungen zur Erblichkeit (Heritabilität):
- Genetischer Anteil: 40–77 %
- Umweltfaktoren: 20–60 %
Diese große Spannweite hängt mit den unterschiedlichen Studiendesigns zusammen. Manche Einflüsse – etwa die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt (Gen-Umwelt-Interaktion) – lassen sich bislang nicht vollständig erfassen.
Eine hohe genetische Komponente bedeutet keine feste Vorherbestimmung. Gene schaffen lediglich eine Anfälligkeit. Ob sich daraus tatsächlich eine Störung entwickelt, hängt maßgeblich von den Umweltbedingungen ab. Dieselbe genetische Ausstattung kann daher je nach Lebensumfeld zu sehr unterschiedlichen Entwicklungen führen.
Methodische Einschränkungen:
Zwillingsstudien überschätzen den genetischen Anteil möglicherweise, weil dabei weitere Faktoren mit hineinspielen können – etwa eine geteilte pränatale Umwelt, eine ähnliche Behandlung eineiiger Zwillinge oder die Überschneidung von genetischen und Umweltfaktoren (Gen-Umwelt-Kovarianz).
Die tatsächlichen Ursachen (Ätiologie) sind vermutlich noch komplexer, als es aktuelle Modelle abbilden können.
Die zwei Hauptpfade der Entstehung
Die Entwicklung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung folgt typischerweise einem von zwei gegensätzlichen Entwicklungspfaden:
- Pfad 1: Chronische Entwertung
Das Kind erfährt systematische Abwertung, emotionale Kälte oder Vernachlässigung. Es entwickelt ein kompensatorisches Größenselbst als Schutz gegen die erlittenen Kränkungen. Die Grandiosität wird zur Abwehr gegen gefühlte Wertlosigkeit. - Pfad 2: Pathologische Idealisierung
Das Kind wird bedingungslos bewundert, sein Verhalten ständig überhöht, und klare Grenzen fehlen. Es übernimmt dadurch ein unrealistisches Bild der eigenen Größe (Größenselbst), ohne es jemals an der Realität zu prüfen. Das Gefühl von Grandiosität wird einfach übernommen, ohne hinterfragt zu werden.
Gemeinsamer Mechanismus:
Beide Entwicklungswege verhindern die Entstehung eines realistischen Selbstbildes. Das Kind lernt nie, sich gleichzeitig als wertvoll und dennoch fehlbar zu erleben. Es fehlt die Fähigkeit, Stärken und Schwächen zu einem stimmigen Ganzen (kohärentes Selbst) zu verbinden.
Diese Schwarz-Weiß-Wahrnehmung des eigenen Selbst – entweder grandios oder wertlos – ist typisch für die narzisstische Struktur. Weil die Mittelposition fehlt, ist das Selbstwertgefühl extrem anfällig (vulnerabel) für Kränkungen.
Empirische Befunde:
Rückblickende Studien (retrospektiv) bestätigen beide Entwicklungswege. Die Häufigkeit (Prävalenz) variiert: In klinischen Stichproben findet sich häufiger ein Muster von Entwertung, während in nicht-klinischen Bevölkerungsgruppen eher Überbehütung berichtet wird.
Vererbbarkeit der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung weist eine der höchsten Erblichkeitsraten (Heritabilität) unter den Persönlichkeitsstörungen auf.
Torgersen et al. (2000) fanden in einer Zwillingsstudie eine Erblichkeit von rund 77 %. Diese starke genetische Komponente wurde auch in späteren Studien bestätigt, wobei die Schätzungen insgesamt zwischen 40 und 77 % liegen.
Neurobiologische Befunde:
Bildgebende Verfahren zeigen verschiedene Auffälligkeiten im Gehirn:
- verringertes Volumen der grauen Substanz im präfrontalen Kortex
- geringere Aktivität in Bereichen, die mit Empathie verbunden sind
- veränderte Verbindungen im sogenannten Default Mode Network (Ruhezustands-Netzwerk)
Diese Befunde sind jedoch nicht spezifisch für die narzisstische Persönlichkeitsstörung und überschneiden sich mit anderen Störungen.
Grenzen der Interpretation:
Eine hohe Erblichkeit bedeutet keine feste Vorbestimmung. Sie beschreibt lediglich Unterschiede innerhalb einer Bevölkerungsgruppe unter bestimmten Umweltbedingungen. In anderen Umwelten könnte dieselbe genetische Ausstattung zu ganz unterschiedlichen Entwicklungen führen.
Die genauen Ursachen bleiben unklar. Wahrscheinlich werden bestimmte Temperamentsfaktoren vererbt, die in Wechselwirkung mit der Umwelt zur Entstehung der Störung beitragen können.
Entwertender und vernachlässigender Erziehungsstil
Zwei der einflussreichsten Theorien zur Rolle von Entwertung und Vernachlässigung bei der Entwicklung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung stammen von Heinz Kohut und Otto Kernberg.
Kohut: Fehlende mütterliche Empathie als Ursache
Heinz Kohut entwickelte die Selbstpsychologie und sah narzisstische Störungen als Entwicklungsdefizit. Zentral ist das Konzept der empathischen Spiegelung.
Die Spiegelungstheorie:
In einer gesunden Entwicklung spiegeln Bezugspersonen die Gefühle des Kindes zurück und bestätigen sie als gültig (Validierung). Fehlt diese Spiegelung, bleibt das Kind in einer frühen Entwicklungsphase (primär-narzisstische Phase) stecken.
Kritische Einordnung:
Kohuts Fokus auf die Mutter ist zeitgebunden. Moderne Bindungsforschung zeigt:
- Beide Elternteile sind gleichermaßen relevant
- Verschiedene Bezugspersonen prägen die Entwicklung
- Der mütterliche Fokus reflektiert überholte Geschlechterbilder
Weitergabe über Generationen (transgenerationale Transmission):
Eltern mit narzisstischen Anteilen haben häufig auch narzisstische Kinder. Dahinter wirken mehrere Mechanismen:
- genetische Veranlagung (Erblichkeit/Heritabilität bis etwa 77 %)
- Lernen am Vorbild (Modelllernen) dysfunktionaler Muster
- gestörte Bindungsbeziehungen
- emotionale Vernachlässigung oder auch Überforderung/Überstimulation
Das sogenannte „Größenselbst“ entsteht dabei als Kompensation für die gesamte gestörte Beziehungsdynamik – nicht nur durch fehlende Empathie.
Kernberg: Kalte, bewundernde Erziehung als Auslöser
Otto Kernberg verstand Narzissmus aus objektbeziehungstheoretischer Sicht. Für ihn entsteht die Störung durch das Zusammenspiel biologischer Anfälligkeit und problematischer Erziehung.
Das Kernberg-Modell:
Das Kind erfährt paradoxe Erziehung:
- Emotionale Kälte im Alltag
- Selektive Idealisierung bei Leistungen
- Liebe als Belohnung für Perfektion
Mechanismus der Störungsentwicklung:
Das Kind lernt: "Nur wenn ich außergewöhnlich bin, bin ich wertvoll." Normale Bedürfnisse nach Nähe werden ignoriert, Grandiosität wird belohnt. Diese Verknüpfung zwischen Selbstwert und Außergewöhnlichkeit verfestigt sich zur narzisstischen Struktur.
Integration beider Theorien:
Kohut und Kernberg beschreiben unterschiedliche Wege zur selben Störung:
- Kohut: Fehlende Spiegelung führt zu Entwicklungsstillstand
- Kernberg: Verzerrte Bewertung erzeugt pathologische Abwehr
Beide Mechanismen können zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung führen. Die Theorien ergänzen sich – verschiedene Kinder entwickeln über verschiedene Pfade dieselbe Störung.
Bewundernder und idealisierender Erziehungsstil
Ein weiterer Entstehungsweg der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die übermäßige Idealisierung ohne Realitätsbezug.
Mechanismus der Überhöhung:
Das Kind erhält Lob unabhängig von tatsächlichen Leistungen:
- Normale Entwicklungsschritte werden als außergewöhnlich gefeiert
- Mittelmäßige Leistungen werden überhöht
- Fehler werden ignoriert oder umgedeutet
Das Kind internalisiert: "Ich bin grundsätzlich überlegen." Diese Überzeugung wird nie an der Realität getestet.
Inkonsistente Bewunderung als Risikofaktor:
Millon und Davis bezeichneten besonders die widersprüchliche oder wechselhafte Bewunderung (inkonsistente Bewunderung) als problematisch:
- überschwängliches Lob ohne erkennbaren Grund
- plötzliche Gleichgültigkeit oder Ablehnung
- keine verlässliche Verbindung zwischen Verhalten und Reaktion
Diese Unberechenbarkeit erzeugt Unsicherheit. Das übersteigerte Selbstbild (grandioses Selbst) entwickelt sich als Schutz vor dieser verwirrenden Beziehungsdynamik.
Langzeitfolgen:
Ohne eine realistische Rückmeldung kann sich keine gesunde Selbsteinschätzung entwickeln. Die Betroffenen erwarten dann automatische Bewunderung. Erste ernsthafte Kritik oder Misserfolge können schwere narzisstische Krisen auslösen, weil die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Realität plötzlich deutlich wird.
Brummelman-Studie: Eltern formen das Selbstbild ihrer Kinder
Brummelman und Kollegen (2015) führten eine Längsschnittstudie mit 565 Kindern durch, die den Zusammenhang zwischen elterlicher Überbewertung und narzisstischer Entwicklung untersuchte.
Zentrale Ergebnisse:
Elterliche Überbewertung („Mein Kind ist besonderer als andere“) stand in deutlichem Zusammenhang mit narzisstischen Zügen. Elterliche Wärme hingegen förderte einen gesunden Selbstwert – nicht narzisstische Tendenzen.
Der Unterschied:
- Gesunder Selbstwert: "Ich bin okay, wie ich bin"
- Narzissmus: "Ich bin besser als andere"
Die Rolle der Inkonsistenz:
Besonders schädlich ist schwankende Bewunderung:
- Überhöhung bei Erfolg
- Emotionale Kälte bei Normalität
- Unterschwellige Drohung des Liebesentzugs
Diese Konditionierung erzeugt eine Bindung, die von ständiger Leistung abhängt. Grandiosität wird zur Überlebensstrategie.
Methodische Limitationen:
Die Studie zeigt Zusammenhänge, konnte aber noch nicht klären, ob und wie sich narzisstische Züge im Kindesalter später zu einer ausgewachsenen Persönlichkeitsstörung entwickeln. Langzeituntersuchungen laufen hier noch.
Fazit: Mehrere Faktoren wirken zusammen
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht durch ein Zusammenspiel biologischer und psychosozialer Faktoren.
Aktuelle Forschungslage:
Genetik: Mit einer Erblichkeit von bis zu 77 % gehört die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu den am stärksten genetisch beeinflussten Persönlichkeitsstörungen. Gene schaffen dabei eine Anfälligkeit (Vulnerabilität), legen den Ausgang aber nicht fest – die Entwicklung hängt maßgeblich von Umweltfaktoren ab.
Erziehungseinflüsse: Zwei extreme Muster können die Entwicklung fördern:
- chronische Entwertung → das Kind entwickelt eine kompensatorische Grandiosität
- übermäßige Idealisierung → das Kind übernimmt eine übersteigerte Selbstwahrnehmung (internalisierte Grandiosität)
Schutzfaktoren (protektive Faktoren):
Sichere Bindungen, klare Rückmeldungen und emotionale Bestätigung (Validierung) können eine genetische Anfälligkeit (Vulnerabilität) abmildern.
Gen-Umwelt-Interaktion:
Die Entstehung folgt dem sogenannten Diathese-Stress-Modell: Eine genetische Anfälligkeit wird erst durch ungünstige Umweltfaktoren „aktiviert“. Kinder mit hoher genetischer Belastung reagieren empfindlicher auf belastende Erziehung, während widerstandsfähige (resiliente) Kinder selbst extreme Bedingungen besser ausgleichen können.
Diese vielschichtige (multifaktorielle) Entstehung erklärt die Vielfalt (Heterogenität) der Störung. Unterschiedliche Kombinationen von Risiko- und Schutzfaktoren führen zu verschiedenen Subtypen und Schweregraden.
Test auf eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung
Die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung erfolgt durch standardisierte klinische Verfahren. Die Diagnosestellung ist approbierten Psychotherapeuten und Fachärzten für Psychiatrie vorbehalten.
Diagnostische Instrumente:
- Strukturierte klinische Interviews (SKID-II)
- ICD-10- oder DSM-5-Kriterien
- Ergänzende standardisierte Fragebögen
- Verhaltensbeobachtung über mehrere Sitzungen
Wie erfolgt die Diagnose?
Die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung erfolgt in der Regel auf mehreren Ebenen (multimodal):
- Klinische Interviews: strukturierte Befragung zu Persönlichkeitsmerkmalen, Beziehungsmustern und Selbstwahrnehmung
- Standardisierte Fragebögen: zum Beispiel das Narcissistic Personality Inventory (NPI), das Pathological Narcissism Inventory (PNI) oder das Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar (PSSI)
- Fremdanamnese: Gespräche mit Angehörigen oder nahestehenden Personen
Die Bedeutung der Fremdanamnese:
Gerade bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung besonders ausgeprägt. Betroffene erleben sich oft als missverstanden, während Angehörige über Empathiemangel und ausbeuterisches Verhalten berichten.
Diese Unterschiedlichkeit der Perspektiven ist ein wichtiges Diagnosemerkmal. Die eigene Selbstdarstellung („durchsetzungsstark“) steht häufig in starkem Kontrast zu Fremdbeschreibungen („tyrannisch“).
Diagnostische Herausforderungen:
Viele Betroffene wirken zu Beginn charmant und kooperativ. Das narzisstische Muster wird oft erst im Verlauf oder durch Fremdberichte sichtbar. Diese Fähigkeit, eine Fassade aufrechtzuerhalten („Fassadenkompetenz“), kann die Diagnosestellung erheblich verzögern.
Der NPI-15: Ein gängiges Testverfahren
Einer der bekanntesten klinischen Fragebögen zur Selbsteinschätzung ist das Narcissistic Personality Inventory (NPI-15). Er gibt Hinweise darauf, ob narzisstische Persönlichkeitszüge vorliegen – ersetzt aber keine klinische Diagnose.
Narzissmus-Selbsttest
Selbsttests bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben nur begrenzte Aussagekraft. Die Störung wird von den Betroffenen als normal und gerechtfertigt erlebt (ich-synton) – deshalb sehen sie ihr Verhalten nicht als problematisch.
Das Paradox der Selbsteinschätzung:
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung schieben Probleme nach außen (Externalisierung):
- Kollegen gelten als inkompetent
- Partner werden als überempfindlich dargestellt
- die Umwelt „versagt“ – nie sie selbst
Eigene Verhaltensweisen erscheinen ihnen als angemessene Reaktion auf eine unzulängliche Welt.
Wer nutzt Narzissmus-Tests?
Paradoxerweise sind es meist nicht die Betroffenen selbst, sondern:
- Partner, die Erklärungen für schwieriges Verhalten suchen
- Menschen mit Selbstzweifeln, die sich fälschlicherweise verdächtigen
- Angehörige, die Bestätigung für ihre Beobachtungen suchen
Die tatsächlich Betroffenen sehen in der Regel keinen Anlass, sich selbst zu überprüfen. Falls doch, erwarten sie eher eine Bestätigung ihrer Überlegenheit – nicht die Diagnose einer Störung.
Klinische Bedeutung:
Selbstbeurteilungsinstrumente sind bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung wenig verlässlich (valid). Die fehlende Krankheitseinsicht verfälscht die Ergebnisse systematisch. Wesentlich aussagekräftiger sind daher Fremdeinschätzungen und die klinische Beobachtung.
Warum Narzissten sich nicht freiwillig testen lassen
Die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung erfolgt meist als Zufallsbefund:
Typische Diagnosewege:
- Begleitdiagnose bei Depression oder Suchtbehandlung
- Forensische Begutachtung
- Paartherapie auf Druck des Partners
- Berufliche Krise mit erzwungener Intervention
Das diagnostische Paradox:
Wer sich fragt "Bin ich narzisstisch?" zeigt bereits Selbstreflexion, die bei der Störung fehlt. Die Sorge, anderen zu schaden, ist unvereinbar mit narzisstischer Empathielosigkeit.
Reaktion auf die Diagnose:
Manche Betroffene integrieren die Diagnose in ihr grandioses Selbstbild:
- Die Störung wird zur Bestätigung der Besonderheit
- Narzissmus wird als Zeichen von Überlegenheit umgedeutet
- Empathie wird als Schwäche abgewertet
Diese Umdeutung ist selbst Ausdruck der Pathologie. Die Diagnose motiviert nicht zur Veränderung, sondern wird zur weiteren Grandiosität.
Klinische Implikation:
Dass Betroffene ihr Verhalten als normal und gerechtfertigt erleben (Ich-Syntonie), macht die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu einer der schwierigsten Störungen in der Behandlung.
Ohne eigenen Leidensdruck fehlt meist die Motivation zur Veränderung. Häufig scheitert die Therapie schon daran, dass die Betroffenen keine wirklichen Probleme bei sich selbst erkennen.
Narzissmus-Selbsttest
Neben der professionellen Diagnostik gibt es Screening-Instrumente zur ersten Selbsteinschätzung. Diese können Hinweise geben, ersetzen aber keine fachliche Diagnose.
Der folgende kurze Selbsttest orientiert sich an typischen Merkmalen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Er dient zur Orientierung und Sensibilisierung – nicht zur endgültigen Diagnosestellung.
Hinweis: Selbsttests sind bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung nur eingeschränkt aussagekräftig. Da Betroffene ihr Verhalten oft als normal und gerechtfertigt erleben (ich-synton), ist ihre Selbstwahrnehmung häufig verzerrt.
Menschen, die sich kritisch hinterfragen, zeigen bereits eine Reflexionsfähigkeit, die bei ausgeprägtem pathologischem Narzissmus meist fehlt.
Narzisstischer Persönlichkeitsstil vs. Narzisstische Persönlichkeitsstörung
Nicht jeder mit selbstbewussten oder ehrgeizigen Zügen hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Der entscheidende Unterschied liegt in Ausmaß und Funktionsbeeinträchtigung.
Das Kontinuum-Modell:
Narzisstische Züge existieren auf einem Spektrum:
- Gesunder Narzissmus: Selbstvertrauen, Durchsetzungsfähigkeit, Ehrgeiz
- Narzisstischer Persönlichkeitsstil: Ausgeprägte, aber funktionale Züge
- Narzisstische Persönlichkeitsstörung: Pathologische Ausprägung mit erheblicher Beeinträchtigung
Der Übergang ist fließend. Die Grenze zur Störung wird durch die Funktionsfähigkeit und den Leidensdruck definiert – entweder beim Betroffenen oder seinem Umfeld.
Merkmale des narzisstischen Persönlichkeitsstils
Menschen mit narzisstischem Persönlichkeitsstil zeigen ausgeprägte, aber noch funktionale Züge:
- Hohes Selbstvertrauen mit Anerkennungsbedürfnis
- Starker Leistungswille und Statusorientierung
- Kompetitive Grundhaltung
- Selbstfokussierung im sozialen Kontext
Diese Menschen sind oft beruflich erfolgreich. Ihr Ehrgeiz wird in leistungsorientierten Gesellschaften belohnt. Sie können Beziehungen führen, auch wenn diese von Konkurrenzdenken geprägt sind.
Funktionale Anpassung:
Im Unterschied zur Persönlichkeitsstörung können sie:
- Kritik verarbeiten (wenn auch ungern)
- Kompromisse eingehen (wenn nötig)
- Situative Empathie zeigen
- Niederlagen verkraften (nach Kränkungsphase)
Der Stil ist in der Regel so gestaltet, dass er Betroffene selbst nicht belastet (ego-dyston) – bis eine Krise sie zum Hilfesuchen bringt, etwa bei Burnout oder Beziehungsproblemen.
Kompensation und Kosten:
Der narzisstische Persönlichkeitsstil dient oft als Abwehr gegen die Angst vor Mittelmäßigkeit. Die Überzeugung „Durchschnitt bedeutet Wertlosigkeit“ treibt die Betroffenen zu Höchstleistungen – bis hin zur Selbstausbeutung.
Typische Folgen:
- Burnout durch ständige Grenzüberschreitung
- Beziehungskonflikte durch überhöhte Erwartungen
- dauerhafte Kränkbarkeit bei Kritik
- soziale Isolation durch ständigen Konkurrenzdruck
Diese Kosten lassen sich oft lange tragen. Erst ernsthafte Krisen – wie Scheidung, Jobverlust oder Krankheit – können das System ins Wanken bringen. Der Übergang vom funktionalen Stil zur ausgeprägten Störung ist dabei fließend.
Wann wird daraus eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Der Übergang vom Persönlichkeitsstil zur Persönlichkeitsstörung ist fließend und hängt davon ab, ob die Eigenschaften noch funktional sind oder bereits massiven Schaden anrichten.
Die Schwelle zur Störung:
Persönlichkeitsstil: Narzisstische Züge können Vorteile bringen – etwa Erfolg oder Durchsetzungsfähigkeit – solange die Nachteile begrenzt bleiben und die Person in wichtigen Lebensbereichen funktioniert.
Persönlichkeitsstörung: Die Nachteile überwiegen. Typisch sind:
- zerstörte Beziehungen durch mangelnde Empathie
- berufliches Scheitern durch Selbstüberschätzung
- soziale Isolation durch ständige Entwertung anderer
- deutlicher Leidensdruck – bei den Betroffenen selbst oder in ihrem Umfeld
Das Spektrum-Modell:
Narzisstische Ausprägungen bewegen sich auf einem Kontinuum:
- minimal: gesundes Selbstvertrauen
- moderat: narzisstischer Persönlichkeitsstil
- ausgeprägt: starker (subklinischer) Narzissmus
- extrem: narzisstische Persönlichkeitsstörung
Der Wendepunkt ist häufig eine Krise, die die narzisstischen Abwehrmechanismen überlastet. Eigenschaften, die zuvor noch zum Erfolg beigetragen haben, wirken dann plötzlich zerstörerisch.
Die moderne ICD-11 trägt diesem Kontinuum Rechnung: Sie beschreibt Persönlichkeitsstörungen nach Schweregrad und Merkmalen (dimensionale Erfassung), statt sie starr in einzelne Kategorien (kategoriale Diagnosen) einzuteilen. Das spiegelt die klinische Realität besser wider.
Therapie der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Die Behandlung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gilt als eine der größten Herausforderungen in der Psychotherapie. Die Erfolgsraten sind niedrig, und Abbrüche kommen häufig vor.
Strukturelle Behandlungshindernisse:
Ein zentrales Problem ist die sogenannte Ich-Syntonie: Betroffene erleben ihr Verhalten meist als völlig gerechtfertigt. Aus ihrer Sicht liegt das Problem bei anderen – nicht bei ihnen selbst.
Darum kommen sie nur selten aus eigenem Antrieb in Behandlung. Meist geschieht das durch äußeren Druck, etwa durch gerichtliche Auflagen, Konflikte mit Partnern oder berufliche Konsequenzen. Diese fehlende Eigenmotivation erschwert den therapeutischen Prozess von Anfang an.
Therapieresistenz in der Praxis:
Die narzisstische Struktur wehrt sich aktiv gegen Veränderung. Therapeuten werden entweder abgewertet („Sie verstehen mich nicht“) oder idealisiert („Nur Sie verstehen meine Genialität“). Beides verhindert eine echte therapeutische Arbeit. Statt einer emotionalen Öffnung bleibt es bei intellektuellen Erklärungen. Kommt es zu Kränkungen – zum Beispiel wenn der Therapeut klare Grenzen setzt – wird die Therapie oft abgebrochen.
Seltene Wendepunkte:
Veränderungsbereitschaft entsteht manchmal in existenziellen Krisen. Körperlicher Verfall im Alter, totale soziale Isolation oder schwere Krankheit können die narzisstische Abwehr zeitweise durchbrechen. Solche „Gelegenheitsfenster“ (Windows of Opportunity) sind jedoch selten und meist nur von kurzer Dauer. Sobald die akute Krise vorbei ist, schwindet oft auch die Bereitschaft zur Selbstreflexion.
Realistische Prognose:
Selbst unter günstigen Bedingungen bleiben die Erfolge meist begrenzt. Häufig lassen sich lediglich Symptome lindern und die soziale Anpassung etwas verbessern. Eine grundlegende Persönlichkeitsveränderung ist selten. Die Therapie zielt daher oft eher auf Schadensbegrenzung: destruktive Verhaltensweisen reduzieren, nicht sie vollständig auflösen.
Meist steht die Behandlung der Begleiterkrankungen im Vordergrund
Wenn die narzisstische Abwehr versagt, treten häufig zusätzliche Störungen (Komorbiditäten) auf. Die NESARC-Studie zeigt: Über die Hälfte der Betroffenen entwickelt im Verlauf Depressionen, Angststörungen oder Abhängigkeiten von Substanzen.
Klinische Realität:
In der Praxis werden meist die akuten Begleiterkrankungen behandelt – etwa eine Depression nach einer schweren Kränkung, Angststörungen bei Statusverlust oder eine Sucht, die als Bewältigungsstrategie dient.
Die zugrunde liegende narzisstische Persönlichkeitsstörung bleibt dagegen oft unbehandelt: teils, weil sie nicht erkannt wird, teils, weil sie therapeutisch nur schwer erreichbar ist.
Der narzisstische Kollaps:
Wenn alle Kompensationsmechanismen zusammenbrechen – das Gefühl der Grandiosität nicht mehr aufrechterhalten werden kann, keine Bestätigung (narzisstische Zufuhr) mehr verfügbar ist und die Realität nicht länger verleugnet werden kann – entsteht eine existenzielle Krise.
Die Suizidrate von etwa 10–16 % zeigt, wie verletzlich (vulnerabel) Betroffene in diesem Zustand sind. Der Suizid erscheint dann manchmal als letzter Ausweg aus einer als unerträglich empfundenen Normalität. Ohne das schützende Gefühl von Grandiosität bleibt nur Leere.
Pragmatischer Behandlungsfokus:
Die Therapie konzentriert sich daher vor allem auf:
- die Stabilisierung akuter Symptome
- Suizidprävention in Krisen
- die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit
- Schadensbegrenzung im sozialen Umfeld
Eine direkte Arbeit an der narzisstischen Grundstruktur ist selten möglich. Sie würde Einsicht und Veränderungsbereitschaft erfordern, die Betroffenen in der Regel fehlen. Deshalb bleibt die Therapie meist auf die Symptomebene beschränkt – ein unbefriedigender, aber realistischer Kompromiss.
Therapie ist kaum erfolgreich und stellt hohe Anforderungen an Therapeuten
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung gilt als eine der am schwersten zu behandelnden psychischen Störungen. Die Kombination aus fehlender Krankheitseinsicht, inneren Abwehrmechanismen (struktureller Abwehr) und komplexen Beziehungsdynamiken führt dazu, dass die Behandlungserfolge meist sehr gering bleiben.
Grenzen therapeutischer Veränderung:
Selbst unter optimalen Bedingungen bleiben Fortschritte oft oberflächlich. Zwar können Betroffene ihr Verhalten zeitweise anpassen, doch eine tiefgreifende Persönlichkeitsveränderung ist selten.
In Stresssituationen oder Krisen zeigt sich die Brüchigkeit dieser Anpassung – alte Muster brechen sofort wieder durch. Die scheinbare Veränderung ist dann eher eine äußere Mitmach-Haltung (Compliance) als echte Transformation.
Die therapeutische Gratwanderung:
Therapeutinnen und Therapeuten bewegen sich ständig zwischen schwierigen Extremen:
- Konfrontation führt leicht zu Kränkungen und Therapieabbrüchen.
- Zu viel Bestätigung (Validation) verstärkt das Gefühl der Grandiosität.
- Neutrale Haltung wird als Inkompetenz abgewertet.
- Empathie wird oft ausgenutzt.
Fast jede therapeutische Position kann pathologische Reaktionen auslösen.
Destruktive Therapiedynamiken:
Manche Betroffene machen die Therapie unbewusst zum „Kampfplatz“: Sie entwerten die Kompetenz des Therapeuten, inszenieren sich als Idealpatient, verwandeln Sitzungen in intellektuelle Wettkämpfe oder testen systematisch Grenzen.
Solche Dynamiken können die Therapeuten erschöpfen und echten Fortschritt verhindern. Daher lehnen viele Fachkräfte eine Behandlung ab oder überweisen weiter.
Realistische Zielsetzung:
Trotz dieser Schwierigkeiten zeigen spezialisierte Verfahren zumindest begrenzte Wirksamkeit. Das Ziel ist in der Regel nicht Heilung, sondern Schadensbegrenzung:
destruktive Verhaltensweisen zu reduzieren und die soziale Anpassung zu verbessern. Selbst diese bescheidenen Ziele erfordern jedoch erheblichen therapeutischen Aufwand – bei einer insgesamt unsicheren Prognose.
Kognitive Verhaltenstherapie
Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) hat das Ziel, belastende Gedankenmuster (dysfunktionale Kognitionen) und Verhaltensweisen bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu verändern.
Therapeutische Interventionen:
Die KVT nutzt unterschiedliche Techniken:
- Kognitive Umstrukturierung: starres Schwarz-Weiß-Denken („Ich bin perfekt oder wertlos“) soll durch differenziertere Bewertungen ersetzt werden.
- Verhaltensexperimente: in einem sicheren Rahmen werden Überzeugungen überprüft – zum Beispiel die Befürchtung, bei Fehlern sofort verachtet zu werden.
- Videofeedback: Betroffene sehen die Diskrepanz zwischen ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung, etwa wie ihre Ausstrahlung tatsächlich wirkt.
- Empathietraining: Übungen zur Perspektivübernahme sollen das Mitgefühl stärken und die emotionale Resonanz fördern.
Begrenzte Wirksamkeit:
Die Erfolge bleiben meist an der Oberfläche. Betroffene können intellektuell nachvollziehen, dass ihre Muster problematisch sind – doch auf der Gefühlsebene ändert sich wenig. Die Grundstruktur der Persönlichkeit bleibt unangetastet.
Manche machen äußerlich mit, um den Therapeuten zufriedenzustellen, ohne echte Veränderungsabsicht. Kommt es zu Kränkungen, wird die Therapie oft abgebrochen.
Angepasste Therapieziele:
Darum zielt die KVT in der Praxis weniger auf eine grundlegende Persönlichkeitsveränderung, sondern eher auf pragmatische Ziele: eine bessere soziale Funktionsfähigkeit und Krisenmanagement. Die kritische Frage bleibt:
Verändert der Patient tatsächlich etwas – oder verfeinert er lediglich seine Fassade? Manchmal besteht das Risiko, dass die Therapie unbewusst eher die manipulativen Fähigkeiten stärkt als sie zu verringern.
Psychoanalytische und tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie
Die psychodynamischen Ansätze verfolgen sehr unterschiedliche Strategien bei der Behandlung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
Kernbergs übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP):
Otto Kernberg entwickelte einen eher konfrontativen Ansatz. Die Grandiosität wird dabei als Abwehr gegen Gefühle wie Wut, Neid oder Minderwertigkeit verstanden – und direkt angesprochen. Typische Interventionen lauten etwa: „Ihre Entwertung zeigt Ihre Angst vor Abhängigkeit.“
Diese Konfrontationen sollen Abwehrmechanismen aufbrechen, führen aber oft zu Therapieabbrüchen. Denn solche Deutungen lösen schnell Kränkungen aus, die wiederum zur massiven Abwertung des Therapeuten oder zur Verstärkung der Abwehr führen. Studien zeigen, dass über die Hälfte der Behandlungen schon in den ersten Monaten abgebrochen wird.
Kohuts Selbstpsychologie:
Heinz Kohut verfolgte den entgegengesetzten Weg: maximale Empathie statt Konfrontation. Der Therapeut übernimmt dabei die Rolle eines „Selbstobjekts“ und versucht, fehlende elterliche Spiegelung nachzuholen. Wutausbrüche werden mit Verständnis beantwortet – etwa: „Ich verstehe, wie verletzend das war.“
Diese konstante Bestätigung (Validierung) kann jedoch Risiken bergen: Narzissten deuten Empathie leicht als Bestätigung ihrer Grandiosität. Fehlen klare Grenzen, verstärkt das Anspruchsdenken. Der Therapeut wird dann eher zum „Zulieferer“ narzisstischer Zufuhr als zu einem korrigierenden Gegenüber.
Fazit:
Beide Ansätze zeigen bislang nur begrenzte Wirksamkeit. Keine Therapieform konnte sich klar als überlegen erweisen. Die grundlegende Problematik – ob durch Konfrontation oder durch Empathie – bleibt in der Behandlung besonders hartnäckig. Meist lassen sich bestenfalls kleine Verbesserungen in der sozialen Anpassung erreichen.
Schemafokussierte Therapie (SFT)
Die schemafokussierte Therapie (SFT) nach Jeffrey Young wurde ursprünglich für die Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, zeigt aber auch bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine gewisse Wirksamkeit.
Zentrale Schemata bei Narzissmus:
Young beschrieb typische belastende Grundmuster (maladaptive Schemata), die oft schon in der Kindheit entstehen:
- Grandiosität/Anspruch: „Ich verdiene Sonderbehandlung.“
- Unzulänglichkeit/Scham: „Mein wahres Ich ist verachtenswert.“
- Emotionale Entbehrung: „Niemand erfüllt meine Bedürfnisse.“
Diese Muster sind frühe Anpassungen an problematische Beziehungserfahrungen.
Therapeutisches Vorgehen:
Die SFT arbeitet mit verschiedenen Methoden:
- Fragebögen und imaginative Übungen, um die dominanten Schemata zu identifizieren
- Biografische Arbeit, die aktuelle Reaktionen mit Kindheitserfahrungen verbindet – etwa ein Wutausbruch bei Kritik als Reaktivierung früher Beschämung
- Kognitive Techniken, die Annahmen hinterfragen: „Bin ich wirklich wertlos ohne Perfektion?“
- Erlebnisorientierte Methoden wie imaginatives Neubewerten belastender Situationen oder sogenannte Stuhldialoge, bei denen innere Anteile miteinander ins Gespräch gebracht werden
Im Unterschied zur Borderline-Störung zeigen Menschen mit Narzissmus weniger ausgeprägte Wechsel zwischen inneren Zuständen (Moduswechsel), was die Therapie zusätzlich erschwert.
Wirksamkeit:
Die SFT kann moderate Erfolge erreichen: ein besseres Verständnis der eigenen Muster, eine Reduktion von Konflikten und eine gewisse Abschwächung belastender Grundannahmen. Die narzisstische Grundstruktur bleibt jedoch meist bestehen.
Wie andere Ansätze ermöglicht die SFT eher Schadensbegrenzung als eine grundlegende Veränderung. Dass Betroffene ihr Verhalten als normal und gerechtfertigt erleben (ich-synton), begrenzt auch hier die Möglichkeiten der Methode.
Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT)
Die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) von Peter Fonagy soll die Fähigkeit verbessern, eigene und fremde innere Zustände zu verstehen (Mentalisierungsfähigkeit).
Das Mentalisierungsdefizit bei Narzissmus:
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zeigen dabei ein charakteristisches Muster: Das kognitive Verstehen funktioniert („Ich erkenne, dass du traurig bist“), das emotionale Mitschwingen (affektive Mentalisierung) fehlt jedoch („Ich fühle nicht mit“).
Auch die Wahrnehmung der eigenen inneren Zustände ist oft verzerrt – durch das Gefühl von Grandiosität anstelle einer realistischen Selbsteinschätzung.
Therapeutisches Vorgehen:
Die MBT nutzt verschiedene Methoden: Der Therapeut stellt neugierige, offene Fragen („Was ging in Ihnen vor, als Sie kritisiert wurden?“), anstatt sofort Deutungen zu geben. Emotionen werden gemeinsam erkundet, nicht interpretiert.
Die therapeutische Beziehung dient als Übungsfeld. Der Fokus liegt stark auf dem Hier und Jetzt: „Was löst meine Nachfrage in Ihnen aus?“ Auf diese Weise soll die emotionale Resonanz Stück für Stück verbessert werden.
Grenzen bei Narzissmus:
Die MBT wurde ursprünglich für die Borderline-Störung entwickelt und stößt bei Narzissmus an bestimmte Grenzen. Das Problem liegt weniger im kognitiven Verstehen, sondern vor allem im fehlenden Mitfühlen.
Hinzu kommt, dass die Motivation zur echten Perspektivübernahme oft fehlt und die narzisstische Abwehr eine tiefere Selbstreflexion blockiert.
Forschungsstand (Evidenzlage):
Studien zeigen, dass MBT bei narzisstischen Zügen zu gewissen Verbesserungen führen kann – etwa zu einer besseren sozialen Funktionsfähigkeit. Eine grundlegende Veränderung der Persönlichkeitsstruktur ist jedoch selten. Die emotionale Kernproblematik bleibt meist bestehen.
Paartherapie
Paartherapie mit einem narzisstischen Partner gilt als besonders schwierig. Die Erfolgsaussichten sind sehr gering, während das Risiko einer erneuten Traumatisierung des gesunden Partners hoch ist.
Die narzisstische Agenda:
Der narzisstische Partner nutzt die Therapie oft für seine eigenen Zwecke. Er sucht Bestätigung (Validierung) für seine Position, stellt den Partner als „überempfindlich“ oder „problematisch“ dar und versucht, den Therapeuten als Verbündeten zu gewinnen. Nach außen wirkt er dabei charmant und kooperativ.
Therapeutische Fallstricke:
Viele Paartherapeuten sind nicht auf narzisstische Dynamiken vorbereitet. So erscheint der narzisstische Partner häufig vernünftig und kompromissbereit, während der belastete Partner emotional und vorwurfsvoll wirkt. Unbewusst übernimmt der Therapeut dann leicht die Sicht des Narzissten – mit fatalen Folgen.
Re-Traumatisierung des Partners:
Bleibt die Manipulation unerkannt, erlebt der Partner eine erneute Traumatisierung. Die eigene Wahrnehmung wird von einer Autoritätsperson infrage gestellt, Selbstzweifel verstärken sich. Oft entsteht das Gefühl: „Nicht einmal der Therapeut sieht, was passiert.“
Statt Unterstützung bei der Abgrenzung erhält der Partner Druck, sich weiter anzupassen. Auf diese Weise kann die Gaslighting-Dynamik sogar ungewollt verstärkt werden.
Kontraindikation (in der Regel nicht angezeigt):
Wenn eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert ist, ist Paartherapie meist keine geeignete Form. Die narzisstische Struktur nutzt das Setting eher zur Manipulation als zur Veränderung. Sinnvoller sind zwei getrennte Einzeltherapien mit spezialisierten Therapeuten:
Der narzisstische Partner hätte dort die Möglichkeit zur Arbeit an eigenen Mustern, während der gesunde Partner Unterstützung in Abgrenzung und Realitätsprüfung erhält.
Warum gehen Narzissten überhaupt in eine Paartherapie?
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben in der Regel keine innere Motivation (intrinsische Motivation) für eine Therapie. Ihre Teilnahme an Paartherapie verfolgt meist strategische Ziele.
Instrumentalisierung der Therapie:
Der narzisstische Partner nutzt verschiedene Taktiken. Er sucht Bestätigung (Validierung) für seine Position, stellt den Partner als „problematisch“ dar und präsentiert sich selbst als einsichtig und bemüht.
Nach Fehlverhalten dient die Therapie häufig als Mittel zum Image-Management: „Ich tue doch alles für uns“ – ohne echte Veränderungsabsicht. Unter Androhung einer Trennung wird sie zur Hinhaltetaktik, und sobald die akute Gefahr vorbei ist, folgt meist der Abbruch.
Das Besucher-Phänomen:
Der Therapeut Steve de Shazer unterschied drei Arten von Klienten: Kunden (wollen Veränderung), Klagende (sehen das Problem bei anderen) und Besucher (sind zwar körperlich anwesend, aber innerlich nicht beteiligt).
Narzisstische Partner entsprechen typischerweise diesem „Besucher“-Typus – sie erfüllen die formale Anforderung der Anwesenheit, ohne sich wirklich einzulassen.
Vorhersehbare Muster:
Diese Schein-Motivation führt oft zu ähnlichen Verläufen: Anfangs oberflächliche Kooperationsbereitschaft, dann subtile Sabotage, sobald echte Veränderung gefordert wird.
Nach dem Abbruch wird der Vorwurf laut: „Ich war doch in Therapie – du bist das Problem.“ Die bloße Teilnahme wird also im Nachhinein als Beweis eigener Bemühungen instrumentalisiert.
Therapeutische Konsequenz:
Unter diesen Bedingungen wird die Paartherapie leicht zum weiteren Manipulationsinstrument. Anstatt Heilung zu fördern, eröffnet sie neue Möglichkeiten zur Kontrolle und zum Gaslighting. Therapeuten müssen diese Dynamik klar erkennen und – wenn nötig – die gemeinsame Therapie beenden und in getrennte Einzeltherapien überleiten.
Wenn Paartherapie zur Bühne für narzisstische Sabotage wird
Typische Manipulationsstrategien:
Der narzisstische Partner nutzt verschiedene Techniken, um die Kontrolle im therapeutischen Setting zu behalten. Dazu gehört etwa die Abwertung des Therapeuten („nur Bücherwissen“), um dessen Autorität zu untergraben.
Häufig werden auch Internetquellen oder Google-Artikel als „Beweis“ angeführt, dass die Methoden des Therapeuten veraltet seien (Pseudo-Intellektualisierung). Eine weitere Taktik ist die Umkehrung der Rollen: Der Narzisst inszeniert sich als missverstanden, während der Partner als eigentlich „gestört“ dargestellt wird (Opfer-Täter-Umkehr).
Subtile Machtdemonstrationen setzen alle Beteiligten unter Druck. Drohungen, die Therapie abzubrechen, erzeugen Angst beim Partner und Erfolgsdruck beim Therapeuten.
Erfolgsaussichten:
Eine erfolgreiche Paartherapie bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist äußerst selten. Sie erfordert Therapeuten mit Spezialisierung auf Persönlichkeitsstörungen, klare Grenzen gegenüber Manipulationen und oft auch getrennte Einzelsitzungen, um die Realität für den gesunden Partner abzusichern.
Der Fokus kann dabei höchstens auf Verhaltensänderungen liegen – echte Einsicht ist in der Regel nicht zu erwarten.
Risiko der Verschlimmerung:
Paartherapie kann die toxischen Dynamiken sogar verstärken. Der narzisstische Partner lernt die Verletzlichkeiten des anderen noch besser kennen und nutzt therapeutische Konzepte, um die Manipulation zu verfeinern.
Im schlimmsten Fall erhält die Gaslighting-Dynamik durch eine Fehlinterpretation des Therapeuten sogar eine Art professionelle Bestätigung.
Therapeutische Empfehlung:
Wenn eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vermutet wird, ist eine Einzeltherapie für den gesunden Partner meist der bessere Weg. Dort geht es vor allem um Realitätsprüfung, Selbststärkung und klare Abgrenzung.
Paartherapie ist in solchen Fällen oft nicht angezeigt (kontraindiziert) – und kann mehr schaden als nutzen.
Psychopharmaka-Therapie
Eine spezifische medikamentöse Behandlung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt es nicht. Medikamente (Psychopharmaka) werden ausschließlich zur Behandlung zusätzlicher Erkrankungen (Komorbiditäten) eingesetzt.
Symptomatische Behandlung (Pharmakotherapie):
- Antidepressiva (SSRI/SNRI): bei Depressionen, die nach narzisstischen Kränkungen auftreten
- Anxiolytika: kurzfristig bei schweren Angstzuständen – jedoch mit Vorsicht, da das Risiko einer Abhängigkeit besteht
- Stimmungsstabilisierer (Mood Stabilizer): können bei starker Impulsivität helfen, aggressive Durchbrüche zu reduzieren
- Antipsychotika in niedriger Dosierung: bei paranoiden Gedanken oder psychotischen Symptomen in narzisstischen Krisen
Grundlegende Einschränkungen:
Medikamente verändern nicht die narzisstische Grundstruktur – also weder das grandiose Selbstbild, noch das Empathiedefizit oder die Tendenz zur Ausbeutung und Kränkbarkeit. Sie können lediglich die zusätzlichen Symptome stabilisieren.
Schwierigkeiten in der Anwendung (Compliance-Problematik):
Betroffene nehmen Medikamente oft nicht zuverlässig ein. Ihre Ablehnung speist sich häufig aus der Grandiosität („Ich brauche keine Pillen“). Eigenmächtige Dosisänderungen sind verbreitet, und Nebenwirkungen werden schnell als Kränkung erlebt – was wiederum zum Abbruch führt.
Einordnung:
Psychopharmaka sind bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung nur eine begleitende Behandlung, keine ursächliche Therapie. Sie können die begleitenden Symptome lindern, aber nicht die Persönlichkeitsstruktur selbst verändern. Eine medikamentöse „Heilung“ der narzisstischen Störung ist nicht möglich.
Auswirkungen auf Partner und Angehörige
Beziehungen mit Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, zeigen oft typische problematische Muster (dysfunktionale Dynamiken), die zu erheblichen psychischen Belastungen beim Partner führen können.
Typische Beziehungsdynamiken:
Der Verlauf folgt häufig einem wiederkehrenden Muster: Am Anfang steht eine übermäßige Idealisierung, gefolgt von zunehmender Abwertung und oft einem plötzlichen Ende der Beziehung.
Hinzu kommt die systematische Infragestellung der Wahrnehmung des Partners (Gaslighting), die zu erheblichen Selbstzweifeln führen kann. Der ständige Wechsel zwischen Zuwendung und Ablehnung (intermittierende Verstärkung) kann zudem abhängige Bindungsmuster erzeugen.
Psychische Folgen für Partner:
Studien zeigen, dass Partner von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung häufiger psychische Probleme entwickeln, zum Beispiel:
- depressive Episoden
- Angststörungen
- Anpassungsstörungen
- psychosomatische Beschwerden
Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen und der privaten Seite des narzisstischen Partners erschwert es oft zusätzlich, die eigenen Erfahrungen vom Umfeld bestätigt zu bekommen.
Therapeutische Unterstützung:
Partner brauchen deshalb oft eigene therapeutische Begleitung – etwa zur Realitätsprüfung, zur Stabilisierung und zur Entwicklung gesunder Bewältigungsstrategien. Der Fokus liegt dabei auf Selbststärkung und klarer Abgrenzung, nicht auf einer weiteren Anpassung an die problematische Dynamik.
Tiefer eintauchen
Wenn dich die fachliche Perspektive interessiert, findest du hier weitere Fachartikel zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen:
Narzissmus & die anderen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen
Fachbeitrag – Fachbeitrag – Psychopathen: Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.2)
Fachbeitrag – Borderliner: Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.31)
Fachbeitrag – Histrioniker: Die histrionische Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.4)
Literatur:
*1 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5, Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, S. 918, Hogrefe GmbH & Co. KG, 2. korrigierte Auflage 2018
*2 Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD 10 Kapitel V (F), Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis, Horst Dilling, Werner Mombour, Martin H. Schmidt, Elisabeth-Schulte-Markwort (Hrsg.), S. 220f., Hogrefe Verlag AG, 6. überarbeitete Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß ICD-10-GM (German Modification) 2016
*3 Die Narzissmusfalle - Anleitung zur Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis, Reinhard Haller, S. 197ff., Ecowin Verlag, 12. Auflage 2019
*4 vgl.: Die Narzissmusfalle - Anleitung zur Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis, Reinhard Haller, S. 39ff., Ecowin Verlag, 12. Auflage 2019
*5 Stinson, F. S., D. A., Dawson, R. B. Goldstein et al. (2008). Pevelancce, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: results from the wave 2 national epidemilogic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 69(7): 1033 [zitiert nach Narzissmus – Grundlagen – Störungsbilder – Therapie, Stephan Doering, Hans-Peter Hartmann, Otto F. Kernberg, S. 219, Schattauer Verlag, 2. Aktualisierte Auflage 2021
*6 Narzissmus: Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen, Heinz Kohut, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1. Januar 1976
*7 Narzissmus, Aggression und Selbstzerstörung: Fortschritte in der Diagnose und Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen, Otto F. Kernberg, Klett-Cotta, 12. April 2006
*8 Personality Disorders in Modern Life, Theodore Millon, Carrie M. Millon, Sarah Meagher, Seth D. Grossman, Rowena Ramnath, Wiley Verlag, 24. August 2004
- Weiblicher Narzissmus: Der Hunger nach Anerkennung, Bärbel Wardetzki, Kösel Verlag, 2. Auflage 2021
- Männlicher Narzissmus: Das Drama der Liebe, die um sich selbst kreist, Raphael M. Bonelli, Pantheon Verlag, 3. Auflage 2018