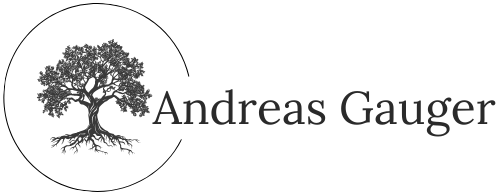Die histrionische Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und ein übertrieben emotionales Auftreten. Die Gefühle wirken oft theatralisch und bleiben dabei eher oberflächlich.
Typische Merkmale sind ein durchgängiges Muster von Aufmerksamkeitssuche, ein Gefühl von Unbehagen, wenn man nicht im Mittelpunkt steht und eine emotionale Darstellung, die häufig inszeniert wirkt und vor allem auf Wirkung zielt.
Was anfangs durch Lebendigkeit und Ausdruckskraft faszinieren kann, verliert oft schnell an Tiefe. Die Emotionen wechseln rasch, wirken wenig authentisch, und Beziehungen erscheinen intensiver, als sie tatsächlich sind.
Das führt zu typischen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten: Partner und Freunde berichten von Erschöpfung durch die ständige emotionale Intensität. Weil schwer erkennbar ist, welche Gefühle „echt“ und welche eher inszeniert sind, leidet das Vertrauen.
So entsteht ein Paradox: Das starke Bemühen um Nähe und Aufmerksamkeit bewirkt häufig genau das Gegenteil – Distanz. Die als unecht wahrgenommene Selbstdarstellung stößt andere ab und verstärkt die innere Unsicherheit.
Hinweis: Dieser Artikel ist ein Fachbeitrag im wissenschaftlichen Stil und richtet sich an fachlich Interessierte, die sich vertieft mit der Histrionischen Persönlichkeitsstörung befassen möchten. Wenn du selbst gerade von toxischen Dynamiken betroffen bist und konkrete Unterstützung suchst, findest du auf dieser Seite jede Menge andere praxisnahe Artikel, die dir Orientierung im Alltag geben.
Definition: Was ist eine Histrionische Persönlichkeitsstörung?
Die histrionische Persönlichkeitsstörung beschreibt ein psychisches Krankheitsbild, bei dem die Betroffenen durch übermäßige Emotionalität und unaufrichtige Verhaltensweisen wie Lügen, das Aufbauschen oder Erfinden von Geschichten, inszeniertes Leiden und manipulatives sowie egoistisches Verhalten alles daran setzen, im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen zu erlangen. Ihr Verhalten ist oft extravagant und theatralisch, was sie in sozialen Situationen auffällig und oftmals faszinierend wirken lässt. Doch diese Darstellung von Emotionen und Erlebnissen ist nicht immer authentisch, sondern dient in erster Linie dazu, ihre Bedeutung und Bestätigung von außen zu suchen.
Verletztes "Wichtigkeitsmotiv" in der Kindheit als Hauptursache
Die histrionische Persönlichkeitsstörung entwickelt sich oft aus frühen Erfahrungen, in denen der Selbstwert nicht ausreichend gespiegelt wurde. Betroffene hatten in der Kindheit nicht das Gefühl, allein um ihrer selbst willen wichtig zu sein.
Um diese Lücke auszugleichen, entstehen kompensatorische Strategien: Die theatralische Selbstdarstellung wird zu einem Weg, die Aufmerksamkeit zu sichern, die damals fehlte. Mit der Zeit verfestigen sich diese Muster und werden Teil einer stabilen Persönlichkeitsstruktur.
Im Rahmen der Cluster-B-Störungen gilt die histrionische Persönlichkeitsstörung als vergleichsweise weniger schwerwiegend. Im Gegensatz zu antisozialen oder Borderline-Störungen ist die Gefahr von Selbst- oder Fremdschädigung geringer – die Belastung für Betroffene und ihr Umfeld bleibt jedoch erheblich.
Zur Geschlechterverteilung: Die Diagnose wird deutlich häufiger bei Frauen gestellt. Fachleute vermuten hier diagnostische Verzerrungen.
Die Kriterien orientieren sich teilweise an geschlechtsstereotypem Verhalten. Männer mit ähnlichen Schwierigkeiten zeigen ihre Muster oft anders – und bleiben dadurch leichter unerkannt.
In Beziehungen zeigt sich ein typisches Muster: Der große Aufmerksamkeitsbedarf und die ständige emotionale Intensität belasten Partner und Freunde erheblich.
Die schnellen Stimmungswechsel und die oft als oberflächlich erlebte Emotionalität erschweren stabile Bindungen. Viele Partner berichten, sich durch die permanente „Bühnenperformance“ erschöpft und ausgelaugt zu fühlen.
Was bedeutet histrionisch?
Die histrionische Persönlichkeitsstörung wurde 1980 ins DSM aufgenommen. Zuvor sprach man von „Hysterie“ – ein Begriff mit einer langen und problematischen Geschichte.
- Schon in der Antike vermutete Hippokrates, dass Frauenleiden durch eine „wandernde Gebärmutter“ entstünden. Der Begriff „Hysterie“ leitet sich vom griechischen hysterikos („an der Gebärmutter leidend“) ab.
- Im Mittelalter galten „hysterische“ Frauen oft als besessen – viele wurden verfolgt oder getötet.
- Um 1900 erkannte Sigmund Freud Hysterie erstmals als psychische Störung mit seelischen Ursachen. Seine Theorien brachten Fortschritte, blieben aber unvollständig und teils problematisch.
Die moderne Konzeption der histrionischen Persönlichkeitsstörung unterscheidet sich grundlegend vom alten Hysterie-Begriff. Trotzdem wirkt die enge historische Verknüpfung mit Weiblichkeit bis heute nach.
Manche Fachleute vermuten, dass die Diagnosekriterien geschlechtsstereotype Verhaltensweisen überbewerten. Das könnte zu einer Überdiagnose bei Frauen und einer Unterdiagnose bei Männern führen.
Der Pschyrembel definiert die histrionische Persönlichkeitsstörung als:

Definition Histrionische Persönlichkeitsstörung
"Spezifische Persönlichkeitsstörung, die durch dramatische Selbstdarstellung, theatralisches Verhalten sowie situationsabhängige übertriebene Affektivität gekennzeichnet ist. Zusätzlich besteht ein überdurchschnittliches Bedürfnis nach Anerkennung. Die Diagnose erfolgt anhand von strukturierten klinischen Interviews, die Behandlung überwiegend psychotherapeutisch. Chronische Verläufe sind häufig."
Die histrionischen Persönlichkeitsstörung gehört zum Cluster B
Die histrionische Persönlichkeitsstörung gehört zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen.
Diese Gruppe ist gekennzeichnet durch starke Gefühlsschwankungen (emotionale Dysregulation), Impulsivität und Schwierigkeiten in Beziehungen.
Zum Cluster B zählen zusätzlich:
- Narzisstische Persönlichkeitsstörung
- Antisoziale Persönlichkeitsstörung
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
Allen gemeinsam sind Probleme in der Beziehungsgestaltung. Sie lassen sich deshalb auch als Beziehungsstörungen verstehen, da die Schwierigkeiten im Umgang mit anderen zentral für die Diagnose sind.
Trotz vieler Überschneidungen (Komorbiditäten) unterscheiden sich die Störungsbilder vor allem durch ihre dominanten Muster und Motivationen:
Bei Borderline steht die Angst vor Verlassenwerden im Zentrum, bei der histrionischen Störung das ständige Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen.
Diagnose und Klinik der Histrionischen Persönlichkeitsstörung
Aufmerksamkeitssuche allein ist keine Störung. Viele Menschen genießen es, im Mittelpunkt zu stehen, ohne dass dies krankhaft wäre.
Der entscheidende Unterschied liegt im Leidensdruck und in der Funktionsfähigkeit. Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung geraten in starken Stress, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen.
Das Fehlen von Aufmerksamkeit löst bei ihnen intensive negative Gefühle aus und beeinträchtigt ihr Leben.
Während normales expressives Verhalten situationsangemessen und flexibel ist, wirkt es bei der histrionischen Störung starr (rigid) und unabhängig vom Kontext.
Die Betroffenen können nicht einfach „abschalten“ – das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit ist dauerhaft und drängend.
Für eine Diagnose müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Die Verhaltensweisen müssen:
- seit dem frühen Erwachsenenalter bestehen
- in verschiedenen Lebensbereichen auftreten
- zu spürbarem Leiden oder Einschränkungen führen
- und dürfen nicht besser durch eine andere Störung erklärt werden
Ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität oder Strebens nach Aufmerksamkeit. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter, und das Muster zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:
- 1Fühlt sich unwohl in Situationen, in denen er/sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
- 2Die Interaktion mit anderen ist oft durch ein unangemessen sexuell verführerisches oder provokantes Verhalten charakterisiert.
- 3Zeigt rasch wechselnden und oberflächlichen Gefühlsausdruck.
- 4Setzt durchweg die körperliche Erscheinung ein, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
- 5Hat einen übertriebenen impressionistischen, wenig detaillierten Sprachstil.
- 6Zeigt Selbstdramatisierung, Theatralik und übertriebenen Gefühlsausdruck.
- 7Ist suggestibel (d.h. leicht beeinflussbar durch andere Personen oder Umstände).
- 8Fasst Beziehungen enger auf, als sie tatsächlich sind.
Diagnosekriterien der ICD-10-GM
Die ICD-10 führt die histrionische Persönlichkeitsstörung unter F60.4. Für eine Diagnose müssen mindestens vier der folgenden Merkmale erfüllt sein:
- Dramatische Selbstdarstellung mit übertriebenem Gefühlsausdruck
- Hohe Beeinflussbarkeit (Suggestibilität) – leicht lenkbar durch andere
- Oberflächliche und instabile Gefühle (labile Affekte)
- Ständige Suche nach Aufregung und Aufmerksamkeit
- Unangemessen verführerisches Verhalten
- Übermäßige Beschäftigung mit äußerer Attraktivität
Zusätzlich können Eigenschaften wie Egozentrik, starkes Verlangen nach Anerkennung oder manipulatives Verhalten vorkommen – sie sind aber nicht zwingend für die Diagnose erforderlich.
Ein Unterschied zwischen den Diagnosesystemen: Die ICD-10 legt besonderen Wert auf die Beeinflussbarkeit und das Bedürfnis nach äußerer Stimulation.
Diese Aspekte erklären, warum Betroffene ständig neue Reize suchen und helfen, die histrionische Störung von anderen Störungsbildern – etwa der narzisstischen Persönlichkeitsstörung – abzugrenzen.
Zur Abgrenzung: Wie Narzissten können auch Menschen mit histrionischer Störung manipulativ wirken.
Der Unterschied liegt jedoch darin, dass sie selbst sehr leicht beeinflussbar sind. Sie suchen äußere Reize, weil ihr inneres Selbstbild unsicher bleibt und eine beständige Identitätsleere erlebt wird.
Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und dem besseren Verständnis von Persönlichkeitsstörungen. Sie ersetzen keine professionelle Diagnose. Eine fundierte Diagnose kann nur durch ausgebildete Fachkräfte wie Psychiater oder klinische Psychologen nach ausführlicher Untersuchung gestellt werden. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungsbilder mit vielen Überschneidungen. Viele Symptome können auch andere Ursachen haben – von Stress über Depression bis zu körperlichen Erkrankungen. Eine Fehleinschätzung kann mehr schaden als nutzen. Nutze das Wissen als Orientierungshilfe, um problematische Verhaltensmuster besser einzuordnen. Wenn du vermutest, dass jemand in deinem Umfeld betroffen sein könnte, betrachte dies als Arbeitshypothese – nicht als feststehende Tatsache. Bei ernsthaften Belastungen oder Gefährdungssituationen such dir professionelle Unterstützung. Das gilt sowohl für den Umgang mit möglicherweise betroffenen Personen als auch für deine eigene psychische Gesundheit.
Fünf Untertypen der Histrionischen Persönlichkeitsstörung
Die Psychologen Millon und Davis beschrieben 1996 fünf mögliche Subtypen der histrionischen Persönlichkeitsstörung. Diese Einteilung beruhte allerdings vor allem auf klinischen Beobachtungen, nicht auf wissenschaftlich überprüften Daten.
Heute sieht man diese Typologie eher als theoretisch interessant, aber nur begrenzt belastbar. Denn:
- es gibt kaum empirische Studien (wissenschaftliche Überprüfung), die die Subtypen bestätigen
- die einzelnen Kategorien überlappen sich stark
- die Ausprägungen wechseln oft je nach Situation und im Verlauf
Die moderne Forschung arbeitet deshalb lieber mit dimensionalen Modellen – also mit einem Kontinuum von Ausprägungen – statt mit starren Schubladen.
In der Praxis zeigt sich: Menschen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung lassen sich selten eindeutig einem Subtyp zuordnen.
Viel wichtiger für die Behandlung sind die individuellen Schwierigkeiten: Welche Probleme stehen im Vordergrund? Gibt es Begleiterkrankungen (Komorbiditäten)? Welche Muster sind im Alltag besonders belastend?
Für die Therapieplanung bedeutet das: Der Fokus liegt nicht auf theoretischen Unterkategorien, sondern auf den konkreten Problemen des einzelnen Menschen.
1. Hypomaner Typus
Der sogenannte „theatralisch-hypomane Subtyp“ erinnert in manchen Aspekten an eine Hypomanie (eine abgeschwächte Form manischer Zustände), unterscheidet sich aber deutlich davon.
Bei einer Hypomanie treten die Symptome in Episoden auf – beim histrionischen Muster handelt es sich hingegen um ein stabiles Persönlichkeitsmuster.
Menschen mit dieser Ausprägung zeigen häufig:
- eine hohe Aktivität und ständige Suche nach Stimulation
- Begeisterung für neue Projekte, die aber selten konsequent abgeschlossen werden
- eine sprunghafte Aufmerksamkeit, die von einem Reiz zum nächsten springt
Im Unterschied zur echten Hypomanie geht es dabei weniger um eine gehobene Stimmung, sondern eher um die Sicherung von Aufmerksamkeit und die Flucht vor innerer Leere.
Diese Rastlosigkeit kann im Alltag zu Problemen führen: Aufgaben bleiben unvollendet, Beziehungen leiden unter der Sprunghaftigkeit, und die ständige Suche nach Neuem erschwert tiefe Bindungen.
Zur Einordnung: Der Begriff „hypoman“ ist etwas irreführend, da er eine Nähe zur bipolaren Störung suggeriert, die so nicht besteht.
Insgesamt bleibt die Subtypen-Einteilung nach Millon und Davis ein theoretisches Modell ohne klare wissenschaftliche Absicherung. In der Praxis zeigen sich meist Mischformen, keine „reinen Typen“.
2. Infantiler Typus
Der sogenannte „infantile Subtyp“ nach Millon und Davis beschreibt Muster von Abhängigkeit und Hilflosigkeit. Schon die Bezeichnung ist problematisch, weil sie schnell stigmatisierend wirkt und ein abwertendes Bild transportiert.
Menschen mit dieser Ausprägung zeigen häufig:
- starke Unselbstständigkeit und das Bedürfnis, dass andere Probleme lösen
- ein Verhalten, das oft naiv-hilflos wirkt, in anderen Situationen aber auch trotzig-fordernd sein kann
- Schwierigkeiten in der Emotionsregulation – mit Stimmungsschwankungen, Anspannung und dem Gefühl innerer Leere
- ausgeprägte Verlassenheitsängste, die zu klammerndem Verhalten führen können und paradoxerweise oft genau die Zurückweisung auslösen, die sie vermeiden möchten
Die beschriebenen Muster überlappen mit anderen Störungsbildern – etwa der abhängigen Persönlichkeitsstörung oder der Borderline-Störung. Das zeigt, wie schwierig und oft künstlich eine klare Abgrenzung ist.
Zur kritischen Einordnung: Manche Theorien behaupten, dass bestimmte „Männertypen“ sich besonders zu diesem Subtyp hingezogen fühlen. Solche Aussagen sind spekulativ und wissenschaftlich nicht belegt.
Sie vereinfachen komplexe Beziehungsdynamiken und können Betroffene zusätzlich stigmatisieren.
Insgesamt bleibt die Subtypen-Theorie von Millon und Davis ein theoretisches Modell ohne solide wissenschaftliche Grundlage. In der klinischen Praxis finden sich meist Mischformen, nicht „reine Typen“.
Eine allzu starre Kategorisierung ist oft wenig hilfreich – und kann sogar kontraproduktiv sein.
3. Schmeichelnder Typus
Der sogenannte „schmeichelnde Subtyp“ nach Millon und Davis beschreibt Muster, bei denen Menschen versuchen, durch Gefälligkeit und Überanpassung Aufmerksamkeit zu sichern.
Diese Form wirkt weniger theatralisch als andere histrionische Ausprägungen, ist aber ebenfalls stark auf Wirkung bedacht.
Typisch sind Verhaltensweisen wie:
- übermäßige Hilfsbereitschaft, die nicht immer erbeten ist
- häufige Komplimente oder Schmeicheleien
- ein starkes Bedürfnis, gemocht zu werden und Anerkennung zu erhalten
Auf den ersten Blick wirkt dieses Verhalten oft wie reine Selbstlosigkeit. Dahinter steht jedoch meist der Wunsch nach Aufmerksamkeit und Bestätigung.
Das Muster ist allerdings instabil: Bleibt die erhoffte Anerkennung aus, kippt das Verhalten oft in Frustration oder Vorwürfe. Dann wird sichtbar, dass die Fürsorglichkeit nicht nur dem anderen gilt, sondern auch ein Versuch ist, die eigene Unsicherheit zu regulieren.
Zur kritischen Abgrenzung: Viele Menschen zeigen ein gewisses Maß an Gefälligkeit oder „People-Pleasing“, ohne dass dies krankhaft wäre. Erst wenn das Verhalten rigide, übermäßig ausgeprägt ist und zu Leidensdruck führt, spricht man von einer pathologischen Qualität.
Wie bei allen Subtypen von Millon und Davis gilt: Diese Einteilung ist theoretisch, wissenschaftlich nicht abgesichert, und in der Praxis finden sich meist Mischformen statt klar abgrenzbarer Typen.
4. Theatralischer Typus
Der sogenannte „theatralische Subtyp“ nach Millon und Davis gilt als die ausgeprägteste Form des dramatischen Verhaltens. Die Selbstdarstellung ist dabei extrem wandelbar und wird stark an das jeweilige Umfeld angepasst.
Typische Merkmale sind:
- eine hohe Rollenflexibilität – das Auftreten verändert sich je nach Publikum und gewünschter Wirkung
- intensive, aber eher oberflächliche Gefühlsdarstellungen – Emotionen werden oft gespielt statt wirklich erlebt
- ein starker Fokus auf äußere Wirkung und Anerkennung
Manche Autoren haben spekuliert, dass Menschen mit dieser Ausprägung häufiger im künstlerischen Bereich tätig seien. Dafür gibt es jedoch keine wissenschaftliche Grundlage.
Umgekehrt haben die allermeisten Schauspieler oder Künstler keine Persönlichkeitsstörung – die Fähigkeit, Emotionen im künstlerischen Kontext auszudrücken, unterscheidet sich deutlich von pathologischer Theatralik.
Problematisch wird das Muster vor allem im zwischenmenschlichen Bereich: Die ständige Anpassung und Rollenwechsel erschweren authentische Beziehungen.
Partner und Freunde wissen oft nicht, wer die Person „wirklich“ ist. So bleibt die Identität diffus und stark von äußerer Bestätigung abhängig – mit dem Risiko einer inneren Leere trotz äußerer Dramatik.
Zur kritischen Einordnung: Romantisierende Darstellungen, Persönlichkeitsstörungen könnten „Vorteile“ haben, sind problematisch. Sie verursachen in erster Linie Leidensdruck und Einschränkungen.
Auch hier bleibt die Subtypen-Theorie von Millon und Davis ein theoretisches Modell ohne wissenschaftliche Absicherung und mit begrenztem Nutzen für die Praxis.
5. Verschlagener Typus
Der sogenannte „verschlagene Subtyp“ nach Millon und Davis wird als besonders manipulativ beschrieben. Diese Charakterisierung ist jedoch problematisch und wissenschaftlich nicht belegt.
Menschen mit dieser Ausprägung zeigen laut Theorie:
- ein starkes Konkurrenzdenken, auch ohne reale Konkurrenzsituation
- subtile Manipulationen, die weniger auffällig, aber wirkungsvoll sein sollen
- ein Verhalten, das stark auf Selbstbehauptung und Wirkung ausgerichtet ist
Die Darstellung als „Meistermanipulatoren“ ist jedoch reißerisch und stigmatisierend. Ein Vergleich mit Psychopathie ist wissenschaftlich nicht haltbar:
Die histrionische Persönlichkeitsstörung unterscheidet sich grundlegend von der antisozialen Persönlichkeitsstörung.
Menschen mit histrionischen Mustern haben in aller Regel Empathiefähigkeit und ein Gewissen – auch wenn ihr Verhalten manchmal manipulierend wirken kann.
Auch die Behauptung, die Symptomatik verschlimmere sich zwangsläufig mit dem Alter, ist nicht durch Studien belegt.
Im Gegenteil zeigen viele Persönlichkeitsstörungen im höheren Alter eher eine Abschwächung der Symptome. Die Vorstellung einer unvermeidlichen Verschlechterung blendet aus, dass es Behandlungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen gibt.
Zur wissenschaftlichen Einordnung: Die Subtypen-Theorie von Millon und Davis ist ein theoretisches Modell, das auf klinischen Eindrücken basiert – nicht auf systematischer Forschung.
Dramatisierende Beschreibungen tragen eher zur Stigmatisierung bei, haben aber kaum therapeutischen Nutzen.
Wie häufig ist die Histrionische Persönlichkeitsstörung?
Die Histrionische Persönlichkeitsstörung in Zahlen
2-3%
der deutschen Bevölkerung sind betroffen
4,3-7,1%
Anteil unter allen psychiatrischen Patienten
Die histrionische Persönlichkeitsstörung ist relativ selten, betrifft aber dennoch eine spürbare Minderheit.
In Deutschland geht man von etwa 2–3 % der Bevölkerung aus – das entspricht rund 1,6 bis 2,5 Millionen Menschen. Auch internationale Studien zeigen ähnliche Größenordnungen.
In psychiatrischen Einrichtungen liegt der Anteil höher: Dort machen Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung laut einer Studie von Loranger et al. (1994) etwa 4–7 % der Patienten aus.
Auffällig ist, dass Frauen deutlich häufiger die Diagnose erhalten (Zimmermann & Coryell 1989, Schotte et al. 1993).
Ob sie tatsächlich öfter betroffen sind oder ob hier diagnostische Verzerrungen eine Rolle spielen – etwa durch geschlechtsspezifische Erwartungen an Verhalten – ist noch nicht abschließend geklärt.
Behandlungsneigung und Diagnose
Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung suchen oft professionelle Hilfe – allerdings meist nicht wegen der Störung selbst, sondern wegen Folgeproblemen.
Ein Grund dafür ist die sogenannte Ich-Syntonie: Das eigene Verhalten wird als selbstverständlich und Teil der Persönlichkeit erlebt, nicht als etwas Krankhaftes.
Theatralische oder stark emotionale Ausdrucksweisen erscheinen den Betroffenen meist wie normale Selbstentfaltung – sie empfinden darin keinen Behandlungsbedarf.
In Behandlung kommen sie typischerweise wegen sekundärer Belastungen, etwa:
- Depressive Episoden, wenn Aufmerksamkeitsstrategien nicht mehr funktionieren
- Beziehungskrisen, wenn Partner erschöpft oder distanziert sind
- Berufliche Schwierigkeiten durch Konflikte im Team
- Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) wie Angststörungen
Manchmal treten auch dissoziative Symptome auf (Erleben von Unwirklichkeit oder Entfremdung). Diese sind aber nicht typisch für die histrionische Persönlichkeitsstörung.
Die Annahme, sie würden auftreten, wenn keine Aufmerksamkeit erlangt wird, ist wissenschaftlich nicht belegt. Dissoziation hängt vielmehr vor allem mit Trauma oder Borderline-Störungen zusammen.
Die Behandlungsprognose ist herausfordernd: Fortschritte entstehen meist erst, wenn der Leidensdruck durch die Folgeprobleme hoch genug ist.
Die Motivation, die Persönlichkeitsmuster selbst zu verändern, bleibt häufig gering – dennoch können Therapie und Unterstützung helfen, die Lebensqualität spürbar zu verbessern.
Häufige Begleiterkrankungen (Komorbiditäten)
Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung zeigen häufig auch Symptome anderer Cluster-B-Störungen – also zum Beispiel narzisstische, borderline-typische oder antisoziale Muster.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei einer Person mehrere Merkmale gleichzeitig auftreten. Diese Überschneidungen sind einer der Gründe, warum Fachleute heute darüber diskutieren, ob die Cluster-B-Störungen tatsächlich so klar voneinander abgrenzbar sind, wie es die Diagnosesysteme darstellen.
Statt völlig eigenständiger Erkrankungen könnte es sich eher um eine gemeinsame Grundproblematik handeln, die sich in unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausprägungen zeigt.
Das Achsenmodell der Persönlichkeitsstörungen der ICD-11 der WHO
Die ICD-11 hat einen neuen Ansatz für Persönlichkeitsstörungen eingeführt. Statt wie bisher einzelne Kategorien (z. B. Borderline oder Histrionisch) zu unterscheiden, beschreibt sie nun Schweregrad und Merkmalsbereiche.
Das bedeutet:
- Es gibt drei Schweregrade – leicht, mittel, schwer
- Erfasst werden Merkmalsbereiche wie z. B. negative Affektivität (starke Stimmungsschwankungen, Anspannung), Distanziertheit (Rückzug, wenig Nähe), Dissozialität (Missachtung sozialer Regeln), Enthemmung (Impulsivität) und Anankasmus (Zwanghaftigkeit)
Die histrionische Persönlichkeitsstörung taucht in diesem System nicht mehr als eigene Kategorie auf. Ihre Symptome werden über die Dimensionen Enthemmung und negative Affektivität beschrieben.
Der Vorteil dieses kontinuierlichen Ansatzes (Kontinuum-Modell): Er spiegelt die Realität besser wider. Persönlichkeitsstörungen sind selten klar abgegrenzt – Menschen zeigen meist Mischungen von Merkmalen in unterschiedlicher Ausprägung.
Die hohen Überschneidungsraten im alten System hatten schon gezeigt, dass starre Schubladen nicht passen.
Die Herausforderung: In der Praxis ist noch das alte System (ICD-10) in Gebrauch. Ärzte, Therapeuten und Abrechnungssysteme arbeiten seit Jahren damit. Die Umstellung erfordert Schulungen und Anpassungen und wird noch einige Zeit dauern.
In der Realität werden daher beide Systeme noch eine Weile parallel genutzt: Die Forschung orientiert sich zunehmend am dimensionalen Modell, während im klinischen Alltag weiterhin die bekannten Kategorien verwendet werden.
Ursachen der Histrionischen Persönlichkeitsstörung
Die Entstehung (Ätiologie) der histrionischen Persönlichkeitsstörung ist nicht eindeutig geklärt. Studien zeigen eine moderate genetische Komponente, aber die eigentliche Entwicklung wird vor allem durch psychosoziale Faktoren erklärt.
Ein zentrales Thema ist die fehlende authentische Bestätigung in der Kindheit. Kinder, die nicht um ihrer selbst willen gesehen und ernstgenommen werden, entwickeln oft kompensatorische Strategien, um Aufmerksamkeit zu sichern.
Typische elterliche Einflüsse können sein:
- Inkonsistente Aufmerksamkeit – das Kind wird nur beachtet, wenn es besonders dramatisch reagiert
- Oberflächliche Rückmeldungen – Lob für Aussehen oder Leistung, nicht für die Person selbst
- Emotionale Vernachlässigung, auch wenn materiell alles vorhanden ist
Zwei Extreme von Erziehungsmustern tauchen immer wieder auf:
- Übermäßige Idealisierung („mein Kind ist ganz besonders“), ohne echte emotionale Nähe
- Vernachlässigung mit gelegentlichen Ausbrüchen von überschwänglicher Aufmerksamkeit
Beide Varianten verhindern die Entwicklung eines stabilen Selbstbildes.
Zur Geschlechterfrage: Frauen erhalten die Diagnose deutlich häufiger. Das könnte daran liegen, dass bestimmte soziale Rollenerwartungen (z. B. „emotional, verführerisch, dramatisch“) stärker mit den Diagnosekriterien übereinstimmen.
Männer mit ähnlichen Grundproblemen zeigen ihre Muster oft anders – und werden deshalb seltener diagnostiziert.
Zur kritischen Einordnung: Die Ursachenforschung zur histrionischen Persönlichkeitsstörung ist bislang weniger entwickelt als bei anderen Störungen. Viele Annahmen beruhen eher auf klinischen Beobachtungen als auf gesicherten Studien.
Biographischer Hintergrund der Histrionischen Persönlichkeitsstörung
Die histrionische Persönlichkeitsstörung wird häufig mit frühen Erfahrungen von Nicht-Wahrgenommenwerden (Invalidierung) in Verbindung gebracht. Viele Betroffene berichten, dass ihre Bedeutung und Bedürfnisse in der Kindheit nicht wirklich gesehen wurden.
Wenn Eltern emotional wenig verfügbar sind oder nur auf extremes Verhalten reagieren, lernt das Kind: Dramatik bringt Aufmerksamkeit. So entwickeln sich kompensatorische Strategien, die später zur Selbstdarstellung und zum ständigen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit führen.
Fehlt die authentische Spiegelung – also das Gefühl, um seiner selbst willen wertvoll zu sein –, entsteht kein stabiles Selbstgefühl. Stattdessen verfestigt sich die Überzeugung: „Ich bin nur wichtig, wenn ich etwas darstelle.“
Die spätere theatralische Selbstdarstellung kann deshalb als Versuch verstanden werden, das nachzuholen, was in der frühen Kindheit gefehlt hat – nämlich bedingungslose Bestätigung.
Zur Einschränkung: Diese Modelle basieren vor allem auf klinischen Beobachtungen und Erinnerungen von Betroffenen.
Eindeutige Langzeitstudien, die die Ursachen zweifelsfrei belegen könnten, fehlen weitgehend. Wahrscheinlich ist die Entstehung multifaktoriell – frühe Erfahrungen wirken zusammen mit Temperament, sozialem Umfeld und einer gewissen genetischen Anfälligkeit (Vulnerabilität).
Abwehrstrategien gegen in der Kindheit erlebte Ohnmachtsgefühle
Die histrionische Persönlichkeitsstörung kann als eine Bewältigungsstrategie früher Erfahrungen verstanden werden. Die permanente Aufmerksamkeitssuche dient dabei der Abwehr von Gefühlen von Bedeutungslosigkeit.
Die theatralische Selbstdarstellung, starke Gefühlsausdrücke und das ständige Suchen nach Aufmerksamkeit sind Versuche, die erlebte Unsichtbarkeit in der Kindheit zu kompensieren. Was damals hilfreich war, wird im Erwachsenenalter oft zu einem hinderlichen Muster.
Die Fixierung auf äußere Bestätigung verhindert die Entwicklung einer stabilen Identität. Viele Betroffene berichten von Unsicherheit über eigene Werte, Ziele oder Vorlieben.
Das Verhalten verstärkt sich selbst: Die intensive Suche nach Bestätigung wirkt auf andere oft unecht und stößt ab. So wächst die Angst vor Bedeutungslosigkeit – und die Bemühungen, Aufmerksamkeit zu bekommen, nehmen noch zu.
Ein zentrales Problem ist die Identitätsunsicherheit. Ohne klares Selbstbild bleibt die Person abhängig von Rückmeldungen von außen. Die eigene Identität wird je nach Situation neu „inszeniert“.
Für die Therapie bedeutet das: Es braucht den Aufbau von Selbstwahrnehmung und innerer Bestätigung. Das ist meist ein langer Prozess, da die Orientierung nach außen tief verankert ist.
Das Bedürfnis nach ständiger Stimulation und externer Bestätigung
Die fehlende Selbstkenntnis führt bei Menschen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung oft zu einer starken Abhängigkeit von äußerer Stimulation. Intensive Erlebnisse sollen die empfundene innere Leere überdecken.
Stimulationssuche als Kompensation: Die permanente Suche nach Aufregung und neuen Erfahrungen ersetzt ein stabiles inneres Selbstgefühl. Ruhe oder Alleinsein werden nicht als erholsam, sondern als bedrohlich erlebt.
Diese Rastlosigkeit unterscheidet sich von gesunder Abenteuerlust. Sie ist getrieben, nicht frei gewählt. Stille macht die Leere spürbar – deshalb muss ständig „etwas passieren“.
Problematische Konsequenzen:
- Beziehungen bleiben oberflächlich, weil Tiefe und Beständigkeit schwer auszuhalten sind
- Projekte werden selten abgeschlossen, Erfahrungen nicht wirklich integriert
- das Leben wirkt wie eine lose Aneinanderreihung von Episoden
Mit der Zeit steigt die Toleranz: Was früher aufregend war, reicht nicht mehr. So kann die Suche nach immer stärkeren Reizen in riskantes Verhalten führen – ohne dass die eigentliche Problematik, die unsichere Identität, gelöst wird.
Hohe Ansprüche an Mitmenschen
Menschen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung stellen oft sehr hohe Erwartungen an ihr Umfeld. Sie wünschen sich ständige Aufmerksamkeit und Bestätigung – doch keine Beziehung kann dieses Maß an Fokussierung dauerhaft leisten.
Enttäuschungen sind deshalb fast unvermeidlich, was regelmäßig zu Frustration und Konflikten führt.
Bleiben Bedürfnisse unerfüllt, entwickeln Betroffene bestimmte Verhaltensweisen, um Aufmerksamkeit zu sichern. Manche zeigen übermäßige Gefälligkeit, andere ziehen sich zurück oder äußern Vorwürfe.
Dieses Verhalten wirkt nach außen oft widersprüchlich, ist aber selten bewusst kalkuliert. Es entspringt vielmehr der verzweifelten Suche nach Bestätigung – einem Muster, das meist schon früh erlernt und tief verankert ist.
Für Partner und Angehörige bedeutet das eine große Belastung. Viele berichten von Erschöpfung durch die ständigen emotionalen Anforderungen.
Die Unberechenbarkeit der Reaktionen schafft eine angespannte Atmosphäre, die häufig dazu führt, dass sich Partner zurückziehen. Für die Betroffenen verstärkt das wiederum die Angst, nicht gesehen oder verlassen zu werden.
Ohne therapeutische Unterstützung ist dieser Kreislauf schwer zu durchbrechen. Hilfreich ist es, wenn Betroffene lernen, realistischere Erwartungen zu entwickeln – und Partner gleichzeitig üben, gesunde Grenzen zu setzen, um nicht auszubrennen.
Psychoanalytische Theorie
Die frühen psychoanalytischen Theorien zur histrionischen Persönlichkeitsstörung sind aus heutiger Sicht eher historisch interessant als wissenschaftlich belegt.
Viele Annahmen stützten sich auf Deutungen – zum Beispiel die Vorstellung, dass ein „früher Verlust der Mutter“ oder bestimmte Vater-Tochter-Dynamiken eine zentrale Rolle spielen.
Solche Modelle entstanden in einer Zeit, in der psychoanalytische Konzepte dominierten, ohne dass sie empirisch überprüft wurden.
Problematisch war dabei auch die Idee, Kinder würden durch „verführerisches Verhalten“ Nähe zum Vater suchen. Damit wurden normale kindliche Bindungsbedürfnisse pathologisiert – und die Verantwortung der Erwachsenen für angemessene Grenzen ausgeblendet.
Empirische Studien zeigen bis heute keine spezifische Familienkonstellation, die eindeutig zur histrionischen Störung führt.
Vielmehr geht man von einer multifaktoriellen Entstehung aus: genetische Anfälligkeiten, Temperament, Umweltfaktoren und frühe Beziehungserfahrungen wirken zusammen.
Auffällig ist zudem der Geschlechtsbias in den alten Theorien. Sie konzentrierten sich fast ausschließlich auf Frauen und Mutter-Tochter-Vater-Dynamiken – ein Spiegel damaliger Rollenbilder, weniger der klinischen Realität.
Männer mit histrionischer Störung passen nicht in dieses Erklärungsmodell.
Moderne Perspektiven betonen heute andere Faktoren: frühe Erfahrungen von Nicht-Wahrgenommenwerden (Invalidierung), das Zusammenspiel von Temperament und Umwelt sowie mögliche neurobiologische Einflüsse.
Diese Ansätze erfassen die Komplexität deutlich besser als die eindimensionären psychoanalytischen Erklärungen der Vergangenheit.
Kognitiv-behaviorale Theorie
Die kognitiv-behaviorale Perspektive sieht die histrionische Persönlichkeitsstörung als Ergebnis von Lernprozessen und inneren Überzeugungen. Im Gegensatz zu den alten psychoanalytischen Modellen ist dieser Ansatz empirisch deutlich besser belegt.
Kinder lernen früh, welches Verhalten Aufmerksamkeit bringt. Wenn Eltern vor allem auf übertriebenes oder dramatisches Verhalten reagieren und ruhige Signale übersehen, wird genau diese Dramatik verstärkt.
Besonders wirksam ist es, wenn die Reaktionen unregelmäßig kommen – das Kind weiß nie genau, wann es gesehen wird, und steigert dadurch seine Bemühungen.
Mit der Zeit entstehen bestimmte Grundannahmen, die das Denken und Handeln prägen. Häufig sind das Überzeugungen wie: „Ich bin unfähig“ oder „Ich muss von allen geliebt werden.“
Diese Sätze wirken wie unsichtbare Leitlinien. Sie führen dazu, dass das eigene Verhalten immer wieder Bestätigung sucht – und die ursprüngliche Unsicherheit dadurch noch größer wird.
Kurzfristig bringt das theatralische Verhalten tatsächlich Aufmerksamkeit. Langfristig bleibt jedoch der Preis hoch: Beziehungen werden oberflächlich, das Umfeld fühlt sich erschöpft, und die eigene Unsicherheit verstärkt sich.
In der Therapie werden diese Muster aufgegriffen. Die kognitiv-behaviorale Therapie arbeitet daran, solche Grundüberzeugungen zu erkennen, im Alltag zu überprüfen und durch neue Strategien zu ersetzen.
Ziel ist es, die ständige Suche nach externer Bestätigung zu verringern und innere Stabilität aufzubauen.
Histrionischer Persönlichkeitsstil vs. Histrionische Persönlichkeitsstörung
Persönlichkeitsstile sind charakteristische Muster im Denken, Fühlen und Verhalten. Sie gehören zur normalen Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten und sind nicht automatisch krankhaft.
Zwischen einem Persönlichkeitsstil und einer Persönlichkeitsstörung gibt es keine harte Grenze, sondern ein Kontinuum.
Ein dramatisch-emotionaler Stil wird erst dann zur histrionischen Störung, wenn er zu erheblichem Leidensdruck oder spürbaren Einschränkungen in Beruf und Beziehungen führt.
Wichtige Unterschiede sind dabei:
- Flexibilität: Kann die Person ihr Verhalten anpassen oder bleibt es starr?
- Anpassungsfähigkeit: Funktioniert das Muster in verschiedenen Situationen oder führt es immer wieder zu Problemen?
- Beeinträchtigung: Gibt es deutliche Einschränkungen im Alltag und in Beziehungen?
- Leidensdruck: Empfindet die Person selbst ihr Erleben als quälend?
Menschen mit einem dramatischen Persönlichkeitsstil sind oft ausdrucksstark, emotional und stehen gerne im Mittelpunkt. Sie können andere begeistern und wirken charismatisch.
Im Unterschied zur Störung können sie diese Eigenschaften aber situationsangemessen einsetzen, ohne dass ihr Leben oder ihre Beziehungen dadurch nachhaltig beeinträchtigt sind.
Nicht jeder ausgeprägte Persönlichkeitsstil entwickelt sich zu einer Störung. Stabile Beziehungen, beruflicher Erfolg oder die Fähigkeit zur Selbstreflexion können schützend wirken.
Umgekehrt können Traumata oder Krisen dazu beitragen, dass sich ein ursprünglich funktionaler Stil in eine problematische Störung verschärft.
Für die Behandlung ist die Unterscheidung entscheidend: Ein Persönlichkeitsstil braucht keine Therapie – eine Persönlichkeitsstörung dagegen schon.
Der Histrionische Persönlichkeitsstil
Der dramatisch-emotionale Persönlichkeitsstil ist die gesunde Variante dessen, was bei einer histrionischen Störung problematisch werden kann. Menschen mit diesem Stil sind ausdrucksstark, lebendig und ziehen mit ihrer Begeisterungsfähigkeit andere oft in den Bann.
Im Unterschied zur Störung bleibt ihr Verhalten flexibel und situationsangemessen. Sie können im Mittelpunkt stehen, wenn es passt – aber genauso gut im Hintergrund bleiben.
Ihre Emotionalität wirkt echt, nicht inszeniert. Sie lassen sich inspirieren, behalten aber ihre eigenen Überzeugungen. Ihre Spontaneität wirkt bereichernd, nicht destruktiv.
Dieser Stil hat viele positive Seiten. Menschen mit dramatisch-emotionalem Stil sind gute Kommunikatoren, knüpfen leicht Kontakte und können andere motivieren.
Das macht sie in Berufen wie Verkauf, Marketing, Lehre oder Führung erfolgreich – überall dort, wo es auf Ausdruckskraft und Begeisterungsfähigkeit ankommt.
Die Grenze zur Störung ist fließend. Problematisch wird es erst, wenn die Flexibilität verloren geht, die Authentizität durch eine Fassade ersetzt wird und Beziehungen oder Alltag darunter leiden.
Solange Lebendigkeit, Ausdrucksstärke und Kontaktfreude in Balance bleiben, handelt es sich um einen Stil, nicht um eine Störung.
Histrionische Persönlichkeitsstörung
Die Unterscheidung zwischen Persönlichkeitsstil und Persönlichkeitsstörung liegt vor allem im Grad der Beeinträchtigung und in der Flexibilität des Verhaltens.
Menschen mit einem dramatisch-emotionalen Stil können ihr Verhalten anpassen. Sie stehen gerne im Mittelpunkt, müssen es aber nicht. Ihre Emotionalität ist flexibel, sie können in unterschiedlichen Situationen variieren und Beziehungen stabil gestalten.
Bei der histrionischen Störung ist das anders: Das Verhalten wirkt starr und zwanghaft – Aufmerksamkeitssuche ist fast unvermeidlich. Wichtig ist dabei: Betroffene erleben ihr Verhalten meist nicht als Problem.
Die Störung ist in der Regel ich-synton, also mit dem Selbstbild vereinbar. Der Leidensdruck entsteht eher durch die Folgen – zerbrochene Beziehungen, berufliche Konflikte oder soziale Schwierigkeiten –, nicht durch eine bewusste Einsicht in die eigene Problematik.
Der entscheidende Unterschied liegt daher in der Funktionsfähigkeit. Menschen mit einem Stil können beruflich erfolgreich sein und stabile Beziehungen führen. Bei einer Störung sind genau diese Bereiche oft massiv beeinträchtigt.
Statt von klar getrennten Kategorien zu sprechen, ist es hilfreicher, die Störung als Teil eines Kontinuums zu verstehen. Die Übergänge sind fließend.
Belastungen oder Krisen können einen funktionalen Stil in Richtung Störung verschieben, während Therapie und persönliche Entwicklung umgekehrt zu mehr Stabilität führen können.
Ist eine Histrionische Persönlichkeitsstörung therapierbar?
Die Behandlung der histrionischen Persönlichkeitsstörung ist komplex, wird aber oft problematischer dargestellt, als sie tatsächlich ist. Besonders die Beschreibung von Betroffenen als „manipulativ“ ist stigmatisierend.
Viel hilfreicher ist es, ihr Verhalten als Ergebnis früher Beziehungserfahrungen zu verstehen.
Eine der größten Herausforderungen liegt in der Ich-Syntonie: Betroffene erleben ihr Verhalten nicht als krankhaft, sondern als Teil ihrer Persönlichkeit.
Sie suchen deshalb selten wegen der Persönlichkeitsstruktur Hilfe, sondern meist wegen Folgeproblemen wie Depressionen, Beziehungskrisen oder beruflichen Konflikten.
Auch in der Therapie zeigen sich die typischen Muster – emotionale Intensität, der Wunsch nach Aufmerksamkeit, manchmal auch schnelle Wechsel in der Darstellung.
Das sollte nicht als bewusste Täuschung interpretiert werden, sondern als erlernte Beziehungsstrategie, die tief verankert ist.
Die therapeutische Beziehung kann dadurch sehr intensiv werden. Manche Therapeuten berichten von Faszination, andere von Erschöpfung. Deshalb ist Supervision wichtig, um diese Dynamiken zu reflektieren und professionell zu halten.
Zur Wirksamkeit: Die Forschungslage ist begrenzt, doch es gibt Hinweise, dass kognitive Verhaltenstherapie helfen kann, starre Denkmuster aufzulockern.
Auch psychodynamische Ansätze können nützlich sein, wenn es darum geht, alte Beziehungserfahrungen zu bearbeiten. Insgesamt gilt die Evidenz jedoch als schwächer als bei anderen Persönlichkeitsstörungen.
Therapieziele müssen realistisch bleiben. Eine „vollständige Heilung“ ist unwahrscheinlich.
Erreichbar sind jedoch Fortschritte wie mehr Selbstwahrnehmung, stabilere Beziehungen und eine spürbare Reduktion des Leidensdrucks durch begleitende Symptome. Dafür braucht es meist einen langen Atem und stabile therapeutische Rahmenbedingungen.
Meist steht die Therapie der Begleiterkrankungen im Vordergrund
Menschen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung suchen meist nicht wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur Hilfe, sondern wegen Folgeproblemen – etwa Depressionen, Ängsten oder akuten Beziehungskrisen.
Das macht die Behandlung herausfordernd: Sobald sich die akuten Symptome bessern, sinkt häufig die Therapiemotivation. Die tieferliegende Persönlichkeitsproblematik bleibt dann oft unbearbeitet.
Auch in der Therapie zeigt sich das vertraute Muster: der Wunsch nach Aufmerksamkeit, die emotionale Intensität, manchmal auch schnelle Wechsel in der Darstellung. Das ist jedoch kein bewusstes Kalkül, sondern Ausdruck der eingeübten Beziehungsmuster.
Der therapeutische Fokus liegt häufig zunächst auf der Linderung der Begleitsymptome. Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur selbst sind möglich, aber langwierig.
Erfolge zeigen sich eher in drei Bereichen: mehr Selbstwahrnehmung, stabilere Beziehungen und eine deutliche Reduktion des Leidensdrucks durch Begleitsymptome.
Für diesen Prozess ist die therapeutische Beziehung zentral. Sie muss klar strukturiert sein, mit professioneller Distanz und Grenzen – nicht nur mit Geduld. Ohne ein gewisses Problembewusstsein bleiben Fortschritte begrenzt.
Betroffene gehen selten wegen ihrer Histrionischen Persönlichkeitsstörung in Therapie
Die histrionische Persönlichkeitsstörung führt nur selten dazu, dass Betroffene von sich aus therapeutische Hilfe suchen. Da das Verhalten meist als zum Selbst passend (ich-synton) erlebt wird, fehlt oft die Einsicht, dass überhaupt eine Behandlungsbedürftigkeit besteht.
Die Forschungslage ist im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsstörungen schwach. Es gibt bisher keine größeren kontrollierten Studien, die spezifische Therapieformen systematisch untersucht hätten. Viele Empfehlungen beruhen auf klinischer Erfahrung oder Einzelfällen.
Ein verbreitetes Missverständnis ist die Vorstellung, Betroffene müssten lernen, „ihre Bedürfnisse allein zu erfüllen“. Das greift zu kurz.
Menschen sind soziale Wesen mit legitimen Bindungsbedürfnissen. Das Problem liegt nicht in Abhängigkeit an sich, sondern in der Art, wie Beziehungen gestaltet werden. Ziel der Therapie ist daher nicht Unabhängigkeit, sondern die Entwicklung stabilerer und funktionalerer Beziehungsmuster.
Auch die häufige Beschreibung als „manipulativ“ ist irreführend. Das Verhalten folgt erlernten Strategien zur Sicherung von Nähe und Aufmerksamkeit – es ist selten bewusst kalkuliert, sondern Ausdruck tieferliegender Muster.
Realistische Therapieziele sind eine Verbesserung der Selbstwahrnehmung, die Entwicklung stabilerer Identitätsaspekte, ein breiteres Spektrum emotionaler Ausdrucksweisen und erfüllendere Beziehungen.
Die Prognose bleibt individuell sehr unterschiedlich. Fortschritte sind möglich, erfordern jedoch meist lange Prozesse – und setzen voraus, dass genügend Motivation für Veränderung vorhanden ist.
Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient stellt eine der größten Herausforderungen dar.
Die therapeutische Beziehung bei histrionischer Persönlichkeitsstörung verlangt eine besondere Balance: zu viel Zuwendung kann alte Muster verstärken, zu wenig führt leicht zu Abbruch.
Entscheidend ist nicht „Zurückhaltung“, sondern eine klare, konsistente Präsenz – ein Rahmen, in dem Betroffene neue, funktionalere Beziehungserfahrungen machen können.
Wichtig ist, die Schwierigkeiten nicht als „fehlende Autonomie“ zu deuten.
Menschen mit histrionischer Störung sind nicht grundsätzlich unselbstständig – die Problematik liegt in der Gestaltung von Beziehungen, nicht im Mangel an Eigenständigkeit. Die therapeutische Beziehung wird so selbst zum Übungsfeld für Veränderung.
Zur Wirksamkeit der Behandlung gibt es bislang nur begrenzte Forschung. Weder kognitive Verhaltenstherapie noch psychodynamische Ansätze sind spezifisch für diese Störung systematisch untersucht.
Beide können helfen, aber die Evidenz ist schwach. Medikamente können begleitende Probleme wie Depressionen oder Angst lindern, verändern aber nicht die Persönlichkeitsstruktur selbst.
Die Behandlung ist herausfordernd, aber keineswegs aussichtslos. Moderate Verbesserungen sind möglich – etwa in der Lebensqualität, der Selbstwahrnehmung und in Beziehungen.
Entscheidend ist die Therapiemotivation, die oft gering bleibt. Eine romantisierende Sprache von „langen Reisen“ hilft hier nicht weiter – wichtiger ist eine realistische Einschätzung der Chancen und Grenzen.
Umgang mit Betroffenen
Der Umgang mit Menschen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung erfordert klare Grenzen und realistische Erwartungen. Angehörige und Partner sollten wissen: Sie können unterstützen, aber nicht „retten“ oder die Störung durch besonderes Verhalten heilen.
Hilfreich sind vor allem klare und konsistente Kommunikation, gesunde persönliche Grenzen und die Vermeidung von Mustern, die das problematische Verhalten unbeabsichtigt verstärken.
Oft ist es auch sinnvoll, dass Angehörige selbst professionelle Beratung oder Unterstützung in Anspruch nehmen, um mit der Belastung besser umzugehen.
Die Verantwortung für echte Veränderung liegt letztlich bei der betroffenen Person selbst. Angehörige können Halt geben – aber den Weg der Veränderung können sie nicht anstelle des anderen gehen.
Tiefer eintauchen
Wenn dich die fachliche Perspektive interessiert, findest du hier weitere Fachartikel zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen:
Narzissmus & die anderen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen
Fachbeitrag – Narzissten: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.8)
Fachbeitrag – Fachbeitrag – Psychopathen: Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.2)
Fachbeitrag – Borderliner: Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.31)
Literatur:
*1 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5, Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, S. 914ff., Hogrefe GmbH & Co. KG, 2. korrigierte Auflage 2018
*2 Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD 10 Kapitel V (F), Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis, Horst Dilling, Werner Mombour, Martin H. Schmidt, Elisabeth-Schulte-Markwort (Hrsg.), S. 167, Hogrefe Verlag AG, 6. Überarbeitete Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß ICD-10-GM (German Modification) 2016
*3 Persönlichkeitsstile – Wie man sich selbst und anderen auf die Schliche kommt, Rainer Sachse, S. 83ff., Junfermann Verlag Paderborn, 2019
*4 vgl.: Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen, Stephan Doering, Rainer Sachse, https://www.ipp-bochum.de/n-kop/psychotherapie-bei-persoenlichkeitsstoerungen.pdf
*5 Motivation und Persönlichkeit - Interaktionen psychischer Systeme, Hogrefe Verlag, 1. Auflage 2001